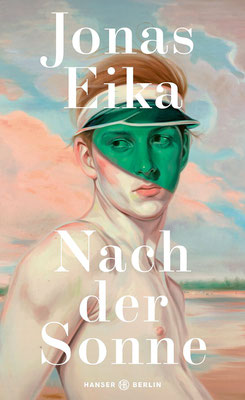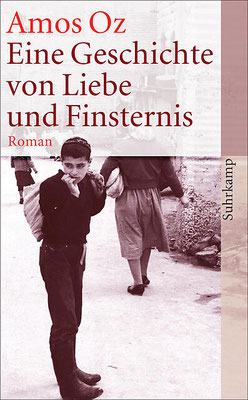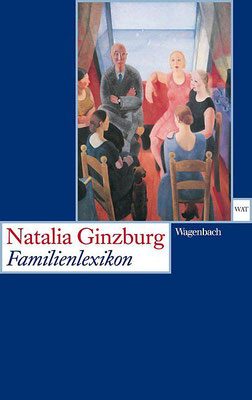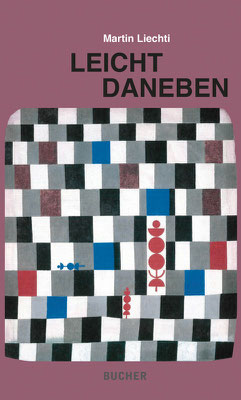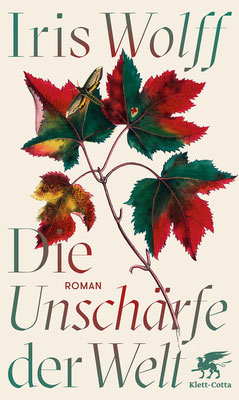ARCHIV
Hier finden Sie unsere vergangenen Veranstaltung.

Mittwoch, 11. Juni 2025
Margit Schreiner
Über das Private
Das Werkstattgespräch
Moderation: Elisabeth Boner

Mittwoch, 14. Mai 2025
Christian Haller
Mehr als die Hälfte der Träume
Der Anfang
Moderation: Felix Ghezzi

Mittwoch, 9. April 2025
Lange Nacht der Debüts
Florian Bissig, Joanna Yulia Kluge, Selma Kay Matter, Nora Osagiobare, Steven Schneider
Eine Doppel-Veranstaltung in Kooperation mit dem Literaturhaus Zürich
Moderation: Julia Knapp (Literarischer Club Zürich) | Isabelle Vonlanthen (Literaturhaus Zürich)

Mittwoch, 12. März 2025
Marlen Haushofer
«Eigentlich kann ich nur leben, wenn ich schreibe»
Der
Klassikerinnen-Abend
Gespräch mit Liliane Studer (Herausgeberin der «Gesammelten Erzählungen» von Marlen Haushofer)
Moderation: Elisabeth Boner

Mittwoch, 12. Februar 2025
Usama Al Shahmani
«Ein Seidenfaden zu den Träumen»
Die Poesie-Bühne
Moderation: Julia Knapp

Mittwoch, 8. Januar 2025
Zoë Jenny
«Die Nachtmaschine – Matthyas Jenny: Ein literarisches Leben»
Das Buch und das Leben dahinter
Moderation: Urs Heinz Aerni

11. Dezember 2024
Gertrud Leutenegger
«Vorabend» (1975)
Der Anfang
Moderation: Julia Knapp
Ein junges Mädchen schreitet in Zürich jene Strassen ab, auf denen am nächsten Tag eine Demonstration stattfinden soll. Dieser äusserliche Gang der Geschichte
ist nur Anlass zu poetischen Gängen, zum Aufkeimen
und Aufbrechen von Erinnerungen an Früheres, an Kindliches. Es klingt etwas an vom trauerlos hellen Verlust eines inneren Zentrums.
Das Dasein findet sich in anderen Personen wieder, in anderen Zuständen, in Erlebnissen ihrer Jungmädchenzeit auf dem Land, beim Tod des Vaters, bei einem
Aufenthalt in England und in Italien.
In ihrem 1975 erschienenen Romandebüt zeigt Gertrud Leutenegger mehr als die Wirklichkeit einer Demonstration, nämlich die Rettung von untergesunkenen
geräuschlosen Protesten, von all jenen subtileren Manifestationen, «die unter der flaumig grauen Decke jedes Tages aufzittern».
In unserem Programmformat «Der Anfang» sprechen wir mit renommierten Autor*innen über ihren ersten Roman.
Gertrud Leutenegger, geboren 1948 in Schwyz, veröffentlicht seit 1975 Romane, Essays, Gedichte und Theaterstücke; ein Werk, für das sie zuletzt mit dem Solothurner Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Sie lebt in Zürich.
Foto: © Felix Ghezzi
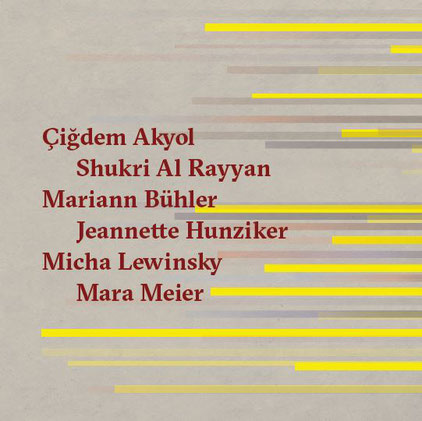
13. November 2024
Lange Nacht der Debüts
Çiğdem Akyol, Shukri Al Rayyan, Mariann Bühler, Jeannette Hunziker, Micha Lewinsky, Mara Meier
Moderation: Annette König und Isabelle Vonlanthen
Eine Doppel-Veranstaltung in Kooperation mit dem Literaturhaus Zürich
Orte: Literaturhaus Zürich / Cabaret Voltaire
Sechs Schweizer Debüts an einem Abend – Ein literarisches Feuerwerk und ein Einblick in vielfältige Erzählstimmen und -welten!
Entdecken Sie an nur einem Abend eine Vielzahl spannender neuer Autor*enstimmen, Erzählweisen und Geschichten! Ab sofort laden wir Sie mit einem neuen Partner ein, dem Literaturhaus Zürich, und nehmen Sie auf einen Spaziergang mit: Die erste Hälfte der Debütnacht findet im Literaturhaus statt – für die zweite Hälfte gehen wir gemeinsam ins Cabaret Voltaire.
Aufgetretene Autor*innen:
Çiğdem Akyol («Geliebte Mutter – Canım Annem», Steidl)
Shukri Al Rayyan («Nacht in Damaskus», Edition Bücherlese)
Mariann Bühler («Verschiebung im Gestein», Atlantis Verlag)
Jeannette Hunziker («Für immer alles», Lenos Verlag)
Micha Lewinsky («Sobald wir angekommen sind«, Diogenes Verlag)
Mara Meier («Makrele vom Lachstyp», Caracol Verlag)
In Kooperation mit dem Literaturhaus Zürich und dem Cabaret Voltaire
Mit freundlicher Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia

9. Oktober 2024
Alexandre Lecoultre et Ruth Gantert – «Peter und so weiter»
L’auteur et sa traductrice (fr/de)
Modération: Martine Grosjean
Cabaret Voltaire, Spiegelgasse 1, 8001 Zürich
En collaboration avec CH Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit
Pour ses personnages décalés, Alexandre Lecoultre utilise des mots et des phrases en dehors des normes langagières usuelles. Il parsème sa prose française de termes
allemands, suisse-allemands, espagnols et italiens. Ruth Gantert a su trouver les correspondances adéquates à ce multilinguisme capricieux, et sa traduction allemande suit aussi les méandres
poétiques dans la recherche de Peter au sujet du bonheur et du sens de la vie.
«Diese Geschichte wandert mit Peter durch die morgendlichen Strassen des Dorfs von Z. Arbeiten, hopp, dabei weiss niemand, was der Bernhard eigentlich macht, c’est vrai ça, was passiert nach dem Hopp? Und wäre Die mit dem Blick der ihn anblickt und dem Lächeln das ihn anlächelt, von der die Nina spricht, zu erkennen?» (aus: «Peter und so weiter»)
Alexandre Lecoultre est l’auteur de romans et de textes poétiques qu’il met en scène lors de performances musicales. Il est également traducteur de textes littéraires
espagnols vers le français.
https://www.alexandrelecoultre.ch/
Ruth Gantert ist Übersetzerin, Literaturvermittlerin, Redaktorin, und u. a. künstlerische Leiterin des Service de Presse Suisse.
Foto Alexandre Lecoultre: © Marco Zanoni
Foto Ruth Gantert: © Daniel Bitterli

11. September 2024
Hiäsig: Gedichte und Geschichten von Hanspeter Müller-Drossaart
Die Poesie-Bühne
Musik: Peter Gisler, Kontrabass, Schwyzer Örgeli
Cabaret Voltaire, Spiegelgasse 1, 8001 Zürich
Hanspeter Müller-Drossaart lud zu einer vergnüglichen Lesung aus seinem neuen Lesebuch hiäsigs ein. Musikalisch wird
er am Kontrabass und auf dem Schwyer Örgeli von Peter Gisler begleitet.
In seinem neuen Buch hiäsigs führt Hanspeter Müller-Drossaart neue Gedichte und erstmals Prosatexte in drei Sprach-Idiomen in verschiedenen
literarischen Formen zusammen. Der Schauspieler, Vorleser und Autor spiegelt und vertieft in verdichteter Sprache das alltägliche menschliche Nebeneinander von abgründiger Melancholie und
aufmunternden Glücksmomenten. Das tut er mit einer humorvollen Ernsthaftigkeit.
Der Begriff «hiäsig» benennt die heimatliche, geografisch-landschaftliche Verortung von Menschen, ihren Lebensweisen, Traditionen und Produkten, auch als gesuchte
Abtrennung vom Fremden, von dem, was «vo dusse» ins geschützte, scheinbar reine Eigene herein wirkt.
Das Buch will lustvoll und reichhaltig unser Bewusstsein universell befragen und den räumlichen, traditionell genährten Geist der Innerschweizer Doppel-Herkunft des
Autors, (Obwalden und Uri), mit sinnlichen und plastischen Texten unterhaltsam erhellen.
Hanspeter Müller-Drossaart ist gebürtiger Obwaldner und bekannt durch Auftritte in TV- und Film-Produktionen,
durch seine Tätigkeit als Vorleser bei Radio und Fernehen (Literaturclub SRF) und seine literarischen Erzähltheater wie «Trafikant» und «Bajass».
Peter Gisler spielt Kontrabass und Schwyzerörgeli, ist u.a. Komponist, Kontrabasslehrer, Verleger. Er erforscht die Entwicklung der alten Tanzmusik in Uri und bringt vergessene Melodien zum Klingen.
Foto: Remo Fröhlicher

12. Juni 2024
Laura Bortot – Übersetzen oder Vom Gehen in weglosem Gelände
Das Werkstattgespräch
Moderation: Jacqueline Aerne
Cabaret Voltaire
In Kooperation mit der CH Stiftung
Sprachen sind wie Landschaften, sie haben ihr eigenes Wesen und ihre Wege können uns durch karge, öde, schroffe, oder aber liebliche, malerische und melodische Gebiete führen.
Die Übersetzerin, die Schritt für Schritt, Wort für Wort, eine solche Literaturlandschaft durchwandert, muss dem spezifischen Gelände Rechnung tragen, die eigentümlichen Stimmung und Formen wahrnehmen, sie verinnerlichen, umschreiben und schliesslich einem anderen Sprachraum zuschreiben.
Doch was zeichnet das Spezifische einer Sprache aus und was macht sie unverwechselbar? Was sind ihre Eigenschaften und wie lassen sich diese in eine andere Sprache übertragen? Wie erlebt die italienische Übersetzerin Laura Bortot ihre Arbeit, wie die Schweizer Literatur? Wie gestaltet sich der Austausch mit den Autor*innen und die landesübergreifende Übersetzungs-Zusammenarbeit mit der ch Stiftung, deren ch Reihe dieses Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert?
Laura Bortot arbeitet als Literaturübersetzerin (Deutsch/Italienisch) und Dozentin für Literarisches Übersetzen an der Hochschule für Translationswissenschaft in Vicenza (Italien). Unter anderen hat sie Helmut Krausser, Thomas Maissen, Leta Semadeni, Angelika Overath, Eva Menasse übersetzt.
Foto: Felix Ghezzi

8. Mai 2024
Literatur darf alles! Darf Literatur alles?
Gespräch mit Melanie Möller und Philipp Tingler
Moderation: Urs Heinz Aerni
Cabaret Voltaire
Das Schreiben und Lesen scheint immer mehr ein Minenfeld zu werden. Die einen befürchten (Selbst-)Zensur, andere verletzte Gefühle. Wie frei darf Literatur sein, wie sehr soll sie Rücksicht nehmen?
Anlass zum Gespräch gibt Melanie Möllers Buch «Der* ent_mündigte Lese:r. Für die Freiheit der Literatur. Eine Streitschrift», in dem sie dem Thema von Homer und der Bibel bis Annie Ernaux auf den Grund geht. Die Philologin argumentiert, dass Literatur frei und wild sein muss und Bücher »beissen und stechen« sollen, wie Kafkas in einem Brief schrieb.
Sind Sie gleicher Meinung oder plädieren Sie für Sensitivity Reading und Triggerwarnungen? Diskutieren Sie mit, wenn Melanie Möller auf Philipp Tingler trifft.
Melanie Möller ist Professorin für Latinistik an der Freien Universität Berlin und schreibt regelmäßig für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2016 erschien ihr Buch Ovid. 100 Seiten, 2017 organisierte sie die Veranstaltungsreihe Bimillennium 2017: Ovid und Europa.
Philipp Tingler studierte Wirtschaftswissenschaften und Philosophie an der Hochschule St. Gallen, der London School of Economics sowie der Universität Zürich und ist mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller. Er ist Kritiker u.a. im «SRF-Literaturclub».
Fotos: Foto: Stefan Sulzer © Philipp Tingler / © Melanie Möller

10. April 2024
Lange Nacht der Debüts
Corinne Ammann, Özlem Cimen, Laura Leupi, Nadine Olonetzky, Lorena Simmel, Levin Westermann
Eine Doppel-Veranstaltung in Kooperation mit dem Literaturhaus Zürich
Moderation: Felix Ghezzi, Isabelle Vonlanthen
Literaturhaus Zürich, Cabaret Voltaire
Sechs Schweizer Debüts an einem Abend – Ein literarisches Feuerwerk und ein Einblick in vielfältige Erzählstimmen und -welten!
Entdecken Sie an nur einem Abend eine Vielzahl spannender neuer Autor*enstimmen, Erzählweisen und Geschichten! Ab sofort laden wir Sie mit einem neuen Partner ein, dem Literaturhaus Zürich, und nehmen Sie auf einen Spaziergang mit: Die erste Hälfte der Debütnacht findet im Literaturhaus statt – für die zweite Hälfte gehen wir gemeinsam ins Cabaret Voltaire.
Wir freuen uns auf diese Autor*innen: Corinne Ammann («über leben», Edition Bücherlese), Özlem Çimen («Babas Schweigen», Limmatverlag), Laura Leupi («Das Alphabet der sexualisierten Gewalt», Märzverlag), Nadine Olonetzky («Wo geht das Licht hin, wenn der Tag vergangen ist», S. Fischer), Lorena Simmel («Ferymont», Verbrecher Verlag) und Levin Westermann («Zugunruhe», Matthes & Seitz).
19:30 Uhr: Lesungen im Literaturhaus: Özlem
Cimen, Levin Westermann, Nadine Olonetzky. Moderation: Felix Ghezzi
20:45 Uhr: Spaziergang ins Cabaret Voltaire, Halbzeitgetränk
21:15 Uhr: Lesungen im Cabaret Voltaire: Lorena Simmel, Corinne Ammann, Laura Leupi. Moderation: Isabelle Vonlanthen
22:30 Uhr: Büchertisch von Never Stop Reading, offene Bar, Bücher signieren und Ausklang
Die Reihenfolge der lesenden Autor*innen steht Anfang März fest!
Orte: Literaturhaus Zürich, Limmatquai 62, 8001 Zürich / Cabaret Voltaire, Spiegelgasse 1, 8001 Zürich
In Kooperation mit dem Literaturhaus Zürich und dem Cabaret Voltaire
Mit freundlicher Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia

13. März 2024
Ludwig Hohl
Vom Hitzegrad der Literatur
Der Klassiker-Abend
Gespräch mit Magnus Wieland
Lesung: Helmut Vogel
Moderation: Felix Ghezzi
«Die Erwägung, ob etwas kompliziert und neu aussehe, und ‹dichterisch› genug für gewisse Leute, hat mich nie leiten können. Es kam mir auf etwas ganz anderes an ... ; vielleicht den Hitzegrad; oder den Härtegrad», so schreibt Ludwig Hohl im Vorwort zu «Die Notizen». Ludwig Hohl zu lesen ist eine intensive Erfahrung. Friedrich Dürrenmatt meinte: «Hohl ist notwendig, wir sind zufällig. Wir dokumentieren das Menschliche,
Hohl legt es fest.»
Ludwig Hohl wurde vor 120 Jahren in Netstal, Glarus, geboren. Zu diesem Anlass sind in der Bibliothek Suhrkamp fünf neue Texte aus Hohls Nachlass
erschienen. Wir werden an der Veranstaltung darauf eingehen, aber auch über die Meisternovelle «Bergfahrt» und die legendären «Notizen» diskutieren. Für viele Schriftsteller*innen ist er
längst ein Klassiker, wir wollen ein breiteres Publikum für diesen Geheimtipp der Schweizer Literatur begeistern.
Magnus Wieland ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Schweizerischen Literaturarchivs in Bern. Dort ist er u.a. für den Nachlass von
Ludwig Hohl zuständig und Herausgeber mehrerer Bücher Hohls.
Helmut Vogel ist Schauspieler, Sprecher, Theatermusiker und Regisseur.

14. Februar 2024
Theres Roth-Hunkeler
«Damenprogramm»
Lesung und Gespräch
Moderation: Julia Knapp
Julia Knapp sprach mit Theres Roth-Hunkelers über ihren neuen Roman «Damenprogramm», ein berührendes, unmittelbar in Bann ziehendes Buch über das Altern, das die Verluste nicht leugnet.
Seit dem sogenannten Damenprogramm ihrer Mütter haben sich die Verhältnisse grundlegend geändert und inzwischen sind Anna und Ruth selbst Damen im «reifen Alter». Die beiden unterschiedlichen Frauen sind beste Freundinnen und auch familiär verbunden, seit Anna Ruths Bruder Arno geheiratet hat. Überdies nimmt Ruth als Patentante regen Anteil am Leben von Annas suchtkranker Tochter Caro, einer komplizierten jungen Frau, die ein Leben auf der Kippe führt. Kipp- und Wendepunkte ganz anderer Art haben auch die Freundinnen erreicht. Während Anna den Tod ihres Demenzkranken Partners Arno verarbeiten muss, beendet Ruth eine unbefriedigende Beziehung. Nicht mehr jung, noch nicht alt, sehen sich die beiden mit einer ungewissen Zukunft und einer Reihe existentieller Fragen konfrontiert. Mal melancholisch, mal satirisch, in jedem Fall ziemlich unerschrocken fragen sie nach den Besonderheiten ihres Lebensabschnitts, und, wie altern jenseits aller Vorbilder und Rollenangebote geht? Was es heißen könnte, sich als gestandene Frau neu zu erfinden. Nicht großmütterlich neutralisiert, weder griesgrämig, noch selbstoptimiert. Anna und Ruth mischen sich ein! Und derweil das Leben weitergeht und nach täglicher Bewältigung verlangt, reift in ihren klugen Köpfen ein ganz neues Damenprogramm und ein konkreter Plan.
Theres Roth-Hunkeler, geboren 1953 in Hochdorf Luzern, lebt heute in Baar bei Zug und oft in Berlin. Schreiben, Lesen und Literaturvermittlung sind die Schwerpunkte, die auch ihre langjährige Lehrtätigkeit an Kunsthochschulen bestimmt haben.
Die Autorin hat neben Erzählungen und journalistischen Texten sechs Romane publiziert, zuletzt das Text-Bild-Werk «Lange Jahre»(2020) mit Bildern der Malerin Annelis Gerber-Halter und den Roman «Geisterfahrten» (2021). In unregelmäßigen Abständen meldet sich Theres Roth-Hunkeler mit ihrem Blog zu Wort. www.roth-hunkeler.ch
Foto: Felix Ghezzi

10. Januar 2024
Thomas Hettche
«Sinkende Sterne»
Das Werkstattgespräch
Moderation: Annette König
Cabaret Voltaire, Spiegelgasse 1, 8001 Zürich
Ein einsames Haus in den Bergen und eine Naturkatastrophe, nach der ein Schweizer Kanton sich plötzlich lossagt von unserer Gegenwart: «Sinkende Sterne» ist ein virtuoser, schwebend-abgründiger Roman, in dem eine scheinbare Idylle zur Bedrohung wird und der uns tief hineinführt in die Welt der Literatur selbst.
Ein Bergsturz hat das Rhonetal in einen riesigen See verwandelt und das Wallis zurück in eine mittelalterliche, bedrohliche Welt. Sindbad und Odysseus haben ihren Auftritt, Sagen vom Zug der Toten Seelen über die Gipfel, eine unheimliche Bischöfin, Sommertage auf der Alp und eine Jugendliebe des Erzählers.
Thomas Hettche schildert die alpine Natur und vergessene Lebensformen ihrer Bewohner, denen in unserer von Identitätsfragen und Umweltzerstörung verunsicherten Gegenwart neue Bedeutung zukommt.
Lesung und Gespräch
Thomas Hettche, 1964 am Rand des Vogelsbergs geboren, studierte Germanistik, Philosophie und Filmwissenschaft
und lebt heute als freier Schriftsteller in Berlin und in der Schweiz. Sein letzter Roman «Herzfaden»
(2020) stand auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis und wochenlang auf der «Spiegel»-Bestsellerliste.
Foto: © Nicole Schneider

6. Dezember 2023
Der Vorstand des Literarischen Clubs präsentierten dem Publikum lesenswerte Bücher. Mit dabei waren Jacqueline Aerne, Martine Grosjean, Domenica Schulz, Felix Ghezzi, Julia Knapp, Annette König und Urs Heinz Aerni (von links nach rechts). Elisabeth Boner, die leider nicht anwesend sein konnte, mailte ihre Buchtipps.
Und das sind die empfohlenen Bücher:
Klicken Sie auf die Titel für mehr Informationen, die Sie auch gleich zur wunderbaren Buchhandlung Bodmer führt, die übrigens auch Mitglied im Club ist:
Diaty Diallo: «Zwei Sekunden brennende Luft»
Pierre Lemaitre: «Wir sehen uns dort oben»
Pierre Lemaitre: «Spiegel des Schmerzes»
Carlos Ruiz Zafon: «Der Schatten des Windes»
Martin Kordic: «Jahre mit Martha»
Simon Chen: «Im Anfang war das Wort»
Ermal Meta: «Morgen und für immer»
Karine Tuil: «Diese eine Entscheidung»
Jürgen Wilbert (Hrsg.): «Deutsche Aphoristik der Gegenwart»
Solvej Balle: «Über die Berechnung des Rauminhalts I»
Plinio Martini: «Nicht Anfang und nicht Ende»
Alba de Céspedes: «Das verbotene Notizbuch»
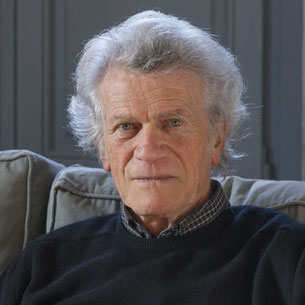
8. November 2023
Alberto Nessi
È una fortuna passeggiare tra i castagni –
Es ist ein Glück, unter Kastanien zu gehen
Lesung und Gespräch in Italienisch und Deutsch
Moderation: Jacqueline Aerne
GZ Hottingen, Hottingersaal
Alberto Nessi è nato nel 1940 a Mendrisio, è cresciuto a Chiasso e ha frequentato la Scuola Magistrale a Locarno e poi l'Università di Friburgo. Insegnante e pubblicista impegnato da sempre nella vita culturale e civica in ambito regionale e nazionale, esordisce nel 1969 con la raccolta poetica I giorni feriali, a cui segue, sempre in ambito poetico "Ai margini" (1975), "Rasoterra" (1983), "Il colore della malva" (1992) e "Blu cobalto con cenere" (2000), "Iris viola" (2004), "Ode di gennaio" (2005), "Un sabato senza dolore" (2016). I lavori di prosa comprendono i racconti di "Terra matta" (1984), "Fiori d'ombra" (1997), "Milò" (2014), i romanzi "Tutti discendono" (1989), "La Lirica" (1998), "La prossima settimana, forse" (2008) e la prosa diaristica di "Corona Blues" (2020). Alberto Nessi è anche autore di radiodrammi, ha partecipato alla creazione di film per la televisione ed è il curatore dell'antologia di testi della Svizzera italiana "Rabbia di vento" (1986). Nel 2016 è stato insignito del Gran Premio svizzero di letteratura, il maggiore riconoscimento letterario elvetico.
Alberto Nessi, 1940 in Mendrisio geboren, in Chiasso aufgewachsen. Er schloss eine Lehrerausbildung in Locarno ab und studierte anschließend
Literaturwissenschaft und Philosophie in Fribourg. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit arbeitete er viele Jahre als Lehrer und als Journalist für verschiedene Zeitungen sowie für das
Tessiner Radio. Das Bundesamt für Kultur verlieh ihm 2016 den Schweizer Grand Prix Literatur für sein Gesamtwerk, die höchste literarische Würding unseres Landes. Im Limmat Verlag sind zahlreiche
seiner Werke – Lyrik und Prosa – in der deutschen Übersetzung von Maja Pflug und Christoph Ferber erschienen, u.a. Mit zärtlichem Wahnsinn / Con tenera follia, Ausgewählte Gedichte; Die
Wohnwagenfrau, Roman; Schattenblüten, Erzählungen; Nächste Woche, vielleicht, Roman; Milò, Erzählungen; Blues in C. – Journal eines Jahres; Blätter und Blässhühner / Foglie e folaghe, ausgewählte
Gedichte 1990–2017. Heute lebt Alberto Nessi als freischaffender Schriftsteller und Publizist in Bruzella, in der Region Mendrisio.
Seit über 50 Jahren schreibt Alberto Nessi mit sprachlichem Feinsinn über das Alltägliche, über Unscheinbares und Nebensächliches, über Randständige und Verlierer, über unverhoffte Begegnungen und Einsichten und immer wieder über die Natur, mit Vorliebe über einfache Gräser und Wiesenblumen, über Obsthaine und Dornenbüsche: Denn Poesie, so sagt Alberto Nessi, "kann jedem Terrain entspriessen".
In einem Streifzug durch sein gesamtes Werk wurde im Gespräch erkundet, wie der Doyen der Literatur der Italienischen Schweiz das Unbekannte im Alltäglichen entdeckt, wie er sich mit respektvoller Neugierde seinen Figuren nähert, um sie dann in seinen Texten aufleben zu lassen.
Foto: © Limmat Verlag

3. September 2023
Julian Schmidli
«Zeit der Mauersegler»
Lesung und Gespräch
Moderation: Felix Ghezzi
GZ Hottingen, Hottingersaal
Nino und Tschüge sind seit der Kindheit beste Freunde. Als Laila mit ihren Eltern aus Kosovo in das Dorf im Berner Oberland kommt und den zwei Jugendlichen den Kopf verdreht, erhält ihre Beziehung erste Risse. Schliesslich verlieren sich die beiden Freunde aus den Augen. Denn während Tschüge die Metzgerei seines Vaters übernimmt und mit Laila zusammenlebt, lebt Nino in einer Stadt, arbeitet als Filmemacher und macht Nebenjobs, um über die Runden zu kommen.
Fünfzehn Jahre später erbt Nino nach dem Tod seines geliebten Grossvaters den leuchtend roten Cinquecento Giardiniera aus dem Jahr 1969 und Tschüge fragt Nino, ob er Trauzeuge an der Hochzeit im Kosovo sein möchte. So kommt es unerwartet zu der Möglichkeit, sich einen der grossen gemeinsamen Träume aus der Kindheit zu erfüllen: zu zweit für neun Tage mit dem Auto frei unterwegs zu sein und auf dem Weg zum Hochzeitsort Abenteuer zu erleben. Denn auch das filmreife Leben, wie es sich die beiden damals ausgemahlen hatten, ist noch nicht eingetroffen. Auf der Fahrt via Alpen und Italien nach Kosovo taucht um jede Kurve tatsächlich eine Überraschung auf, es stellt jedoch in dem viel zu kleinen Fiat auch die Freundschaft von Nino und Tschüge hart auf die Probe.
Julian Schmidlis Debütroman «Zeit der Mauersegler» ist ein rasant und leichtfüssig erzählter «Roadmovie», der gleichzeitig grundsätzliche Fragen zum Wert und den Auswirkungen von Freundschaft, Liebe, Familie, Männlichkeitsbildern und Migration stellt.
Julian Schmidli, geboren 1985 in Pasadena, Kalifornien, und aufgewachsen in Luzern, arbeitet als Datenjournalist und investigativer Reporter für «SRF Data», dem Daten-Team von Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Nebenbei ist er als Dozent zu den Themen Datenjournalismus und Onlinerecherche tätig. Julian Schmidli lebt in Zürich. «Zeit der Mauersegler» (Kein&Aber) ist sein Debütroman.
Foto: © Anne Morgenstern

3. September 2023
Gianna Olinda Cadonau
«Feuerllilie»
Lesung und Gespräch
Moderation: Julia Knapp
GZ Hottingen, Hottingersaal
In einem abgelegenen Bergdorf lernt die Journalistin Vera einen jungen Fremden kennen. Sie schreibt an einem Artikel über rätoromanische Literatur, er hat ein altes Haus geerbt und versucht seine traumatischen Kriegserinnerungen hierhin zu verbannen. Die beiden treffen sich zu Spaziergängen, essen zusammen in der Dorfbeiz und erzählen sich nach und nach mit wenigen Worten von ihrer Vergangenheit. Kálmán erinnert Vera an ihre ältere Schwester Sophia, die ihrerseits in einer eigenen Welt lebt. Als Sophia zu Besuch kommt, begegnet auch sie dem geheimnisvollen Kálmán, und es entsteht eine überraschende Verbindung, die beide verändert.
Mit starken Bildern erzählt Gianna Olinda Cadonau von der Begegnung versehrter Menschen. Ein Roman, der ohne Erklärungen auskommt und gleichzeitig Unsagbares sichtbar macht. Ein universelles, beeindruckendes Debüt.
Der Roman wurde 2022 mit dem Studer/Ganz-Preis für das beste unveröffentlichte Debütmanuskript ausgezeichnet.
«Sprachlich überzeugend unterläuft der Roman Erwartungshaltungen und schafft eine über das Heute hinausführende Aktualität.» Jury des Studer/Ganz-Preises
Gianna Olinda Cadonau, geboren 1983 in Indien, wuchs im Engadin auf, studierte Internationale Beziehungen in Genf und Kulturmanagement in Winterthur. Bei der Lia Rumantscha ist sie für die Kulturförderung verantwortlich, darüber hinaus engagiert sie sich in verschiedenen Institutionen für die Kultur im Kanton Graubünden. Sie schreibt Lyrik und Prosa auf Romanisch und Deutsch. Bisher erschienen zwei Gedichtbände in der editionmevinapuorger. Feuerlilie ist ihr erster Roman. Gianna Olinda Cadonau lebt mit ihrer Familie in Chur.
Foto: Gianna Olinda Cadonau. Foto: Yvonne Böhler

14. Juni 2023
Tabea Steiner
«Immer zwei und zwei»
Lesung und Gespräch
Moderation: Julia Knapp
GZ Hottingen, Hottingersaal
Im Grunde genommen weiß Natali, dass sie nicht so weiterleben will. Nicht in der Freikirche, in die sie ihrem Mann Manuel gefolgt ist, nicht in der Kleinfamilie, die sie kaum mehr atmen lässt.
Doch Zeit um Nachzudenken, bleibt Natali wenig. Mit den beiden Kindern, der Teilzeitstelle an der Schule und der künstlerischen Arbeit als Bildhauerin ist ihr Leben mehr als ausgefüllt. Hinzu kommen Verpflichtungen in der Kirche, ein Ort, in dem die ungeschriebenen Gesetze insbesondere die Lebensräume der Frauen bestimmen.
Als Natali an einer Weiterbildung die freischaffende Theologin Kristin kennenlernt, gerät einiges ins Wanken. Die Begegnung löst eine Verschiebung aus und das System, das Natali bisher gestützt hat, droht in sich zusammenzustürzen.
In Ihrem zweiten Roman «Immer zwei und zwei»dringt Tabea Steiner tief in die engen Strukturen einer religiösen Gemeinschaft ein und zeichnet die Zerrissenheit einer Frau nach, die in keiner der beiden Welten wirklich zu Hause sein kann.
Der 14. Juni steht ganz im Zeichen des Frauenstreiks. Das Ringen um Selbstbestimmung der Protagonistin Natali war im Gespräch zwischen Autorin und Moderatorin Ausgangspunkt für einen Exkurs zur politischen und gesellschaftlichen Situation von Frauen in der Schweiz heute.
Tabea Steiner, Jahrgang 1981, ist auf einem Bauernhof in der Nähe des Bodensees aufgewachsen und hat Germanistik und Geschichte studiert. Sie hat das Thuner Literaturfestival Literaare initiiert, ist Mitorganisatorin des Berner Lesefestes Aprillen und war bis 2022 Mitglied der Jury der Schweizer Literaturpreise. 2011 hat sie an der Autor:innenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin teilgenommen, 2019 war sie LCB-Stipendiatin. 2019 erschien ihr erster Roman «Balg», der für den Schweizer Buchpreis nominiert war. Tabea Steiner lebt und arbeitet in Zürich.
Foto: Tabea Steiner von Ayse Yava

10. Mai 2023
Minu Ghedina
«Korrektur des Horizonts»
Lesung und Gespräch
Moderation: Elisabeth Boner
GZ Hottingen, Hottingersaal
Geboren 1959 in Klagenfurt, aufgewachsen in Innsbruck. Studierte Germanistik und Schauspiel. Nach mehreren Jahren Arbeit an verschiedenen Theatern und beim Film Studium der Bildhauerei bei Alfred Hrdlicka an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Ausstellungen im In- und Ausland. Ihr Stück «Essiggurken» erhielt eine Förderung der Stadt Berlin und wurde dort aufgeführt. Ihre Gedichte erschienen in Literaturzeitschriften. Hilde-Zach-Förderstipendium der Stadt Innsbruck 2020 für den Beginn ihres Debütromans «Die Korrektur des Horizonts» (Otto Müller Verlag).
Zum Roman:
Ada spürt früh, dass ihr Platz im Leben auf äußerst wackligem Untergrund steht. Was bei anderen funktioniert, gilt für sie nicht; was in Kinderbüchern über «Vater, Mutter, Kind» steht, ist ihr fremd. Das sensible Mädchen baut sich eine eigene Bilderwelt und rettet sich in die Schönheit, die ihr als einzige Möglichkeit erscheint, den Irritationen von außen etwas entgegenzuhalten. Wie in einem Tarnkleid tastet sie sich durch die Kindheit und muss immer wieder ihre Welt korrigieren. Ihre Großmutter, bei der sie aufwächst, bietet ihr eine Heimat und eröffnet ihr als Schneiderin auch die wunderbare Welt der Stoffe, der Farben, der Weichheit, der glatten Kühle, des Schimmers, der Spitzen und Bordüren. Ein Theaterbesuch wird zum Schlüsselerlebnis, denn Ada spürt sofort: Dies ist mein Ort. Sie wird eine erfolgreiche Kostümbildnerin, erlebt aber auch Tiefschläge, lernt die falschen Männer kennen und kämpft sich aus ihrer schmerzhaften, verworrenen Geschichte. Ihre Stärken werden stärker, aber die Schwächen bleiben. Als sie am 11. September nach Hause kommt, stürzt auch ihre Welt zusammen, «hier und dort und innen und außen». Erneut verschiebt sich der Horizont und bedarf einer Korrektur.
12. April 2023
Warum die Mimi nie ohne Krimi ins Bett geht
Judith Hödl, Medienchefin der Stadtpolizei Zürich, Peter Hänni, Krimautor und Arzt
Gespräch und Lesung
Moderation: Urs Heinz Aerni
GZ Hottingen, Hottingersaal
«Warum die Mimi nie ohne Krimi ins Bett geht» war ein Riesenhit in den 1960er-Jahren von Bill Ramsey und in der Tat, bis heute feiert der Kriminalroman einen Bestseller nach dem anderen, ist der TV-Krimi am Sonntagabend für viele ein fixer Termin. Auch im Schweizer Fernsehen sorgten Serien wie «Bestatter» und «Wilder» für Traumquoten.
Zum Roman «Belchentunnel» von Peter Hänni
Würden Sie eine Autostopperin mitnehmen, die vor dem Belchentunnel auf dem Pannenstreifen steht? Am 26. September 1983 steigt dort eine bleiche Frau ins Auto von zwei Studentinnen. Im Tunnel prophezeit die Frau, etwas Schreckliches werde passieren, dann verschwindet sie, ohne dass das Auto angehalten hätte.
Am 11. September 2019 ist Tom mit seinem alten VW-Bus auf der Autobahn A2 unterwegs. Obwohl er nicht an Geister glaubt, versichert er sich vor dem Belchentunnel, dass alle Türen verriegelt sind. Eine Stunde später wird Tom, bisher ein unbescholtener Mann, in Hägendorf zum Doppelmörder.
Brisante Themen in einen überzeugenden Krimiplot verpackt, lebensechte Dialoge, lakonischer Humor, viel Lokalkolorit, das zeichnet Peter Hännis Romane aus. Alle waren sie Bestseller: «Samenspende», «Freitod, der 13.», zuletzt «Boarding Time».
Judith Hödl arbeitet seit vielen Jahren bei der Zürcher Stadtpolizei und ist heute die Medienverantwortliche. Es kommt immer wieder vor, dass sie auch Autorinnen und Autoren von Kriminalromanen Auskunft gibt, wie es im richtigen Alltag bei der Polizei zu und her geht. Sie liest selber gerne Krimis.
Peter Hänni, 1958 in Bern geboren, in Solothurn Facharzt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten und für Hals- und Gesichtschirurgie, lebt im Berner Jura in Grandval. Er schrieb mehrere Kriminalromane wie «Rosas Blut», «Samenspende», «Freitod, der 13.», «Boarding Time» und zuletzt «Belchentunnel».
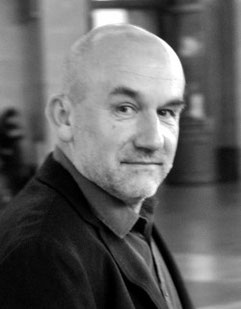
08. März 2023
Karl Rühmann
«Die Wahrheit, vielleicht»
Lesung und Gespräch
Moderation: Annette König
GZ Hottingen, Hottingersaal
Felipe ten Holt hat immer schon zwischen verschiedenen Welten gelebt: als Sohn einer Spanierin und eines Niederländers; als Zielscheibe der Eifersucht seines Stiefvaters, der ihm den Weg zur Mutter versperrt; als Verhörspezialist, der die Wahrheit im Dickicht aus Worten und Gesten, Täuschung und Enthüllung sucht.
Nach einigen beruflichen und privaten Rückschlägen hofft Felipe seinen inneren Frieden in der Arbeit als freier Dolmetscher zu finden. In diesem Beruf ist er zwar – so seine Hoffnung – für die Kommunikation zuständig, aber nicht für deren Folgen. Das soll sich aber als eine Illusion erweisen.
Felipe sucht Zusammenhänge, Verbindungen zwischen Menschen, Dingen, Gedanken, Problemen. Seine Suche ist bezeichnend für eine Zeit, in der man vernetzt vereinsamt und allen Ortungsapps zum Trotz immer wieder die Orientierung verliert.
Karl Rühmann wurde 1959 in Jugoslawien geboren und wuchs dort auf. Er studierte Germanistik, Hispanistik und Allgemeine Literaturwissenschaft in Zagreb und Münster
und war Sprachlehrer und Verlagslektor. Heute lebt er in Zürich als Literaturübersetzer und Autor von Romanen, Hörspielen und zahlreichen, international erfolgreichen Kinderbüchern.
Sein Roman »Der Held« war nominiert für den Schweizer Buchpreis 2020. Für seinen ersten Roman »Glasmurmeln, ziegelrot« wurde Karl Rühmann 2015 mit dem Werkjahr der Stadt Zürich
ausgezeichnet. Publikationen, die nicht bei rüffer&rub erschienen:»Der alte Wolf« (2019), »Eine wundersame Reise« (2018), »Komm mit zum Fluss« (2017), »Leseglück« (2015), »Wer bist
denn du?« (2010) u. a.
Porträtfoto: © Franz Noser

08. Feburar 2023
Zora del Buono
Lesung und Gespräch
Moderation: Josef Estermann
GZ Hottingen, Hottingersaal
Zora del Buono ist in Zürich aufgewachsen. Sie besitzt Wurzeln auch in Slowenien und Apulien. Seit ihrem 25. Altersjahr lebt sie in Berlin, in den letzten Jahren aus familiären Gründen vermehrt in Zürich. Zora del Buono studierte Architektur an der ETH und der Hochschule der Künste in Berlin. Sie arbeitete fünf Jahre als Bauleiterin im Nachwende-Berlin, gründete mit Freundinnen und Freunden das Kulturmagazin «mare», wandelte sich zur Kulturredaktorin, reiste und schrieb.
Seit 2008 lebt sie als freie Autorin. 2008 bis 2011 erscheinen im Marebuchverlag Canitz’ Verlangen, Big Sue und Hundert Tage Amerika. Begegnungen zwischen Neufundland und Key West. 2015 veröffentlichte sie in der Reihe Naturkunden bei Matthes & Seitz den Band Das Leben der Mächtigen – Reisen zu alten Bäumen. 2015 erschien bei C.H.Beck ihre Novelle Gotthard und 2016 der Roman Hinter Büschen, an eine Hauswand gelehnt. 2020 schliesslich erschien in verschiedenen Auflagen und Übersetzungen ihr großer Familienroman «Die Marschallin».

11. Januar 2023
Hanna Sukare
«Rechermacher»
Lesung und Gespräch
Moderation: Elisabeth Boner
GZ Hottingen, Hottingersaal
«Die Wahrheit ist eine Zumutung», heißt es am Ende dieses Romans, dessen Figuren mit ihren Wahrheiten hadern. Es gibt jene, die nichts wissen, und andere, die nicht sprechen wollen. Nelli wagt es irgendwann, an den Tabus ihrer Herkunftsfamilie zu rütteln, nachdem sich die Unkenntnis über ihre Ahnen «wie eine Schleppe aus Blei» auf ihr Leben gelegt hat.
Verstörend und farbenreich zugleich sind die Geschichten, die Hanna Sukare rund um Nellis Großvater August Rechermacher webt. Weit ausholend umspannen sie viele Jahre europäischer Historie. August führt uns Anfang des 20. Jahrhunderts ins «Grasland» des Salzburger Flachgaus, später in die Kasernen des Bundesheeres und der Wehrmacht. Ist er als Soldat zum Täter geworden?, fragen sich Nelli und ihre Tochter. Sie leben und suchen in Heidelberg, England, Wien und immer wieder Salzburg, das als «Scharnier» die Erzählung zusammenhält.
Mit der Familiengeschichte des Dragoners Rechermacher legt Hanna Sukare den dritten Band ihrer Trilogie der Suche vor. Erneut gelingt der Wiener Autorin eine poetische, kraftvolle Geschichte zwischen Fiktion und Fakten. «Rechermacher» ist ein Roman gegen den Krieg und für den Frieden, gegen das Vergessen und für die Zumutung des Erinnerns.
Foto von © Milan Böhm mit Dank an Otto Müller Verlag Salzburg

7. Dezember 2022
Annette König
Literaturkritikerin bei SRF und neues Vorstandmitglied des Literarischen Clubs Zürich
Gespräch
Moderation: Urs Heinz Aerni
GZ Hottingen, Hottingersaal
Welche Bücher liest Du am liebsten?
Bücher, die mir neue Welten eröffnen. Die mich eintauchen lassen in andere Zeiten, andere Kulturen und andere Milieus.
Wenn Du liest, dann ...
... geht das immer ans Substantielle. Ich liebe Bücher, die mich erschüttern, die in mir Gefühle und Erkenntnisse auslösen, die über das Alltägliche hinausgehen. In einem Roman gibt es einen Satz über das Leben in der Schweiz, das sich anfühlt wie ein Luftballon aus dem langsam die Luft ausweicht. Ich will, dass der Ballon entweder ganz schön prall ist, hoch in die Luft hinauffliegt. Oder dann mit einem Knall platzt.
Für einen guten Krimi würdest Du ...
meiner Lieblingskrimiautorin das Skript vom Schreibtisch «ausleihen».
In Deinem Bücherregal findet man ...
... alles! Von Klassikern bis hin zu Krimis. Ausser: Psychothriller und Horrorbücher. Die gibt es da nicht.
Dein schönstes Buch?
Uff. Ich habe unzählige wunderbare Bücher gelesen. Aber vielleicht schlägt ganz tief drin mein Herz für einen englischen Dramatiker: William Shakespeare. Sein Gesamtwerk habe ich in London erstanden.
Erinnerungen an Dein erstes Buch?
Das war Pippi in Taka-Tuka-Land. Ich weiss noch, wie ich es zusammen mit einer blonden Puppe von Sasha Morgenthaler geschenkt bekommen habe. Ich war stolz und ich war sechs.
Das liest Du Deinen beiden Töchtern gerne vor ...
Roald Dahl: «Matilda», Gudrun Pausewang «Die Räuberschule», Ottfried Preussler «Räuber Hotzenplotz», Selma Lagerlöf «Nils Hogerson», Katja Alves «Der Muffin-Club», Cornelia Funke «Die wilden Hühner».
Welches Buch hast Du zweimal gelesen?
Bücher, die ich bespreche, lese ich zweimal. Und wirklich gute Bücher, Klassiker und Co. nehme ich gerne immer mal wieder aus meinem Bücherregal hervor. Mit Vorliebe Max Frisch, Peter Stamm, Hiromi Kawakami, Hemingway, Tschechow, Camus und Sartre. Nur leider fehlt dazu sehr oft die Zeit.
Den Schluss eines Buchs liest du ...
zuletzt!
Annette König: Studium an der Universität Zürich: Germanistik, Politologie und Neue Geschichte. 2013 doktorierte Annette König an der Uni Basel in Neuere Deutsche Literaturwissenschaft mit der Arbeit: «Welt schreiben – Globalisierungstendenzen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur aus der Schweiz». Wer Interesse hat, sie habe genau noch vier Exemplare davon. Und seit 2013 arbeitet sie als Literatur-Redaktorin bei SRF. Sie moderiert an Literaturfestivals und Lesungen auf der Bühne und ist mit dem Journalisten Urs Heinz Aerni mit "Lesen am Tresen" unterwegs, wo sie Bücher vorstellen.

9. November 2022
Sara Catella
«Le malorose»
Lesung und Gespräch italienisch/deutsch
Moderation: Jacqueline Aerne
GZ Hottingen, Hottingersaal
Bleniotal 1912: Eine Hebamme konfrontiert den sterbenden Dorfpfarrer mit der jahrtausendalten Mühsal der Frauen.
All’inizio del Novecento, nel villaggio di Corzoneso, la levatrice Caterina Capra è chiamata al capezzale del parroco don Antonio, che per un male sconosciuto ha perso l’uso della parola. Abituata a trattare i corpi sofferenti delle donne, quelle «malorose» che aiuta a partorire o qualche volta a «liberarsi», nella quiete della stanza del malato Caterina tenta di scacciare l’imbarazzo raccontando a voce alta le vicende del paese.
Col passare dei giorni, le sue «confidenze» cambiano tono: di fronte al prete inerte e muto, la donna si fa coraggio cominciando a incalzarlo con pensieri e domande che la tormentano. La voce schietta e vigorosa della levatrice sale e si gonfia pagina dopo pagina, occupando tutto il silenzio della stanza e accogliendo in sé, in un j’accuse corale, le voci delle molte donne che ha incontrato negli anni.
Con un personale impasto linguistico, in Le malorose l’esordiente Sara Catella compone una galleria di ritratti femminili (ispirati alle fotografie di Donetta) attraverso cui si fa portavoce di una protesta che rimane – anche per noi che crediamo di vivere in un altro mondo – sorprendentemente attuale.
Sara Catella (Lugano, 1980) si è diplomata all’Istituto letterario svizzero di Bienne, in seguito ha ottenuto un Master in scrittura e traduzione letteraria a Berna, città in cui oggi vive. Per le Edizioni Casagrande ha co-tradotto il saggio di Georges Didi-Huberman Passare a ogni costo e un libro del sinologo vodese Jean François Billeter, prossimo alla pubblicazione. Le malorose è il suo primo libro.

12. Oktober 2022
Urs Mannhart
«Geschwind - Oder: Das mutmaßlich zweckfreie Zirpen der Grillen»
Lesung und Gespräch
Moderation: Felix Ghezzi
GZ Hottingen, Hottingersaal
Von den Seltenen Erden sind der Wissenschaft bislang 17 bekannt. Urs Mannhart erfindet eine weitere: Das Rapacitanium. Der Namen ist abgeleitet aus dem französischen rapacité, auf Deutsch: Habgier. Nomen est omen: Der Roman «Geschwind - Oder: Das mutmaßlich zweckfreie Zirpen der Grillenspielt» (Secession Verlag) spielt mit der Annahme, die wohlstandsverliebte Schweiz werde selbst zum Kerngebiet des Abbaus Seltener Erden. Pascal Gschwind, verantwortlich für den globalen Handel mit Rapacitanium, hetzt auf internationale Konferenzen, während zu Hause seine Familie ihn kaum mehr zu Gesicht bekommt, und er steht schließlich vor einem Dilemma: Raubbau an der Natur, an seiner Familie und der eigenen Gesundheit versus Karriere und Geldgeschäfte. Als schließlich ein Berg am Thunersee droht zusammenzufallen, begreift Pascal Gschwind das Ausmaß der Zerstörung seines Handels.
Urs Mannhart, geboren 1975, lebt als Schriftsteller, Reporter und Biolandwirt in der Schweiz. Er hat Zivildienst geleistet bei Grossraubwildbiologen und Drogenkranken, hat ein Studium der Germanistik und der Philosophie abgebrochen, ist lange Jahre für die Genossenschaft Velokurier Bern gefahren, war engagiert als Nachtwächter in einem Asylzentrum und absolvierte auf Demeter-Betrieben die landwirtschaftliche Ausbildung. Mannhart beschäftigt sich mit Tierphilosophie, dem bedingungslosen Grundeinkommen, mit Suffizienz und entschleunigter Mobilität. Für sein literarisches Werk erhielt er eine Reihe von Preisen, darunter den Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis 2017. Im selben Jahr war er zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eingeladen; sein Text stand auf der Shortlist. Viele seiner Reportagen sind entstanden in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Beat Schweizer und der Übersetzerin Jelena Ilinowa.
Mit seinem ersten Roman «Luchs» war er zum ersten Mal Gast im Literarischen Club 2004 im Theater Stadelhofen.

14. September 2022
Maylis de Kerangal
Canoës
Récits
Lesung und Gespräch
Moderation : Martine Grosjean
in französischer Sprache
GZ Hottingen, Hottingersaal
« J’ai conçu Canoës comme un roman en pièces détachées : une novella centrale, “Mustang”, et autour, tels des satellites, sept récits. Tous sont connectés, tous se parlent entre eux, et partent d’un même désir : sonder la nature de la voix humaine, sa matérialité, ses pouvoirs, et composer une sorte de monde vocal, empli d’échos, de vibrations, de traces rémanentes. Chaque voix est saisie dans un moment de trouble, quand son timbre s’use ou mue, se distingue ou se confond, parfois se détraque ou se brise, quand une messagerie ou un micro vient filtrer leur parole, les enregistrer ou les effacer. J’ai voulu intercepter une fréquence, capter un souffle, tenir une note tout au long d’un livre qui fait la part belle à une tribu de femmes — des femmes de tout âge, solitaires, rêveuses, volubiles, hantées ou marginales. Elles occupent tout l’espace. Surtout, j’ai eu envie d’aller chercher ma voix parmi les leurs, de la faire entendre au plus juste, de trouver un “je”, au plus proche. » M. de K.
Maylis de Kerangal a grandi au Havre. Elle est l’auteure de six romans aux Éditions Verticales:
Je marche sous un ciel de traîne (2000)
La vie voyageuse (2003)
Corniche Kennedy (2008), éd. Folio n° 5052
Naissance d’un pont (prix Médicis 2010, prix Franz-Hessel), éd. Folio n° 5339
Réparer les vivants (2014, a reçu dix prix littéraires), éd. Folio n° 5342
Un monde à portée de main (2018), éd. Folio n° 6771
de trois récits dans la collection « Minimales »:
Ni fleurs ni couronnes (2006), éd. Folio n° 6939
Tangente vers l’est (2012, prix Landerneau)
À ce stade de la nuit (2015)
et d’une fiction en hommage à Kate Bush et Blondie:
Dans les rapides, éd. Naives (2007), éd. Folio n° 5788
Maylis de Kerangal a été récompensée par de nombreux prix littéraires, dont le Grand Prix de littérature Henri Gal de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre. Réparer les vivants a été traduit en 35 langues et adapté au cinéma.
Elle vit et travaille à Paris.
Foto: © Mantovani, éd. Gallimard

11. Mai 2022
Dr. Frank Schuhmacher
Populistische Rhetorik in Italien: Von Mussolini bis Salvini
Eine sprachliche Bestandsaufnahme hundert Jahre nach Mussolinis Machtübernahme
Vortrag und Gespräch
Moderation: Jacqueline Aerne
GZ Hottingen, Hottingersaal
Populismus ist kein Phänomen der letzten Jahre, er grassierte bereits im frühen 20. Jahrhundert und zeigte sich dort als eine Mischung aus Extremen: Ein Blick in die Geschichte der politischen Kommunikation in Italien zeigt, dass sich Themen wie Eliten-/Regierungskritik, Feindbilder, schrille Töne und gewaltaufgeladene Metaphern besonders in polemischen Politkauffassungen herausbildeten. Der Faschismus war solch ein politisches Bekenntnis und vor allem Benito Mussolini bediente die Erwartungen breiter gesellschaftlicher Schichten und mobilisierten sie erfolgreich für seine Zwecke.
Anlässlich des 100. Jahrestages des sogenannten «Marsches auf Rom» durch die Faschisten will der Vortrag die Wirkungsmechanismen der populistischen Rhetorik aufdecken und Kontinuitäten wie Brüche zwischen früher und heute in den Blick nehmen.
Frank Schuhmacher wurde 1990 in Spaichingen (Baden-Württemberg) geboren. Er studierte Allgemeine Rhetorik und Politikwissenschaften in Tübingen und Perugia (Italien). In seiner Dissertation (2021) befasste er sich mit den rednerischen Strategien des italienischen Diktators Benito Mussolini mit dem Schwerpunkt auf Mythen und auf das gesellschaftliche Imaginäre. Wie konnte Mussolini zwanzig Jahre lang seine Herrschaft sichern und auch Zustimmung für sein Regime generieren? Mythen, so seine These, nahmen in diesem Prozess eine eminent wichtige Stellung ein. (Das Buch erscheint diesen Herbst im Fink-Verlag: «Benito Mussolini. Konsens durch Mythen») Zurzeit ist Frank Schuhmacher am Seminar für Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Seine Forschungsgebiete umfassen Stilistik, Geschichte der Rhetorik, Propaganda und politische Kommunikation.

13. April 2022
Rolf Lappert und Ludwig Hasler
Ausgeschrieben? Mitnichten. Aber was macht das Älterwerden mit dem Schreiben?
Gespräch
Moderation: Urs Heinz Aerni
GZ Hottingen, Hottingersaal
Wie prägt das Schreiben unsere Wahrnehmung und was macht das Älterwerden damit? Warum ist noch längst nicht ausgeschrieben, wo doch schon alles gesagt zu sein scheint? Funktioniert das Erlenen des sogenannten Kreativen Schreibens? Verfällt der Literaturbetrieb in den Jugendwahn, wie es oft von älteren Autorinnen und Autoren empfunden wird und keine Chance mehr bei Verlagen bekommen für ein Alters-Debüt? Warum ist das Leben durch die Sprache ein doppeltes?
Dieses Gespräch wurde durch das Buch «Für ein Alter, das noch was vorhat» von Ludwig Hasler angeregt und durch «Jung & Alt» (beide Bücher: Rüffer & Rub Sachbuchverlag) von Samantha Zaugg und Ludwig Hasler. Letzteres ist eine Art Briefwechsel in Form von Kolumnen in der Zeitung «Schweiz am Wochenende» zwischen der 27-jährigen Journalistin und Filmerin und dem 77-jährigen Philosophen und Publizist.
Ludwig Hasler, 1944, studierte Philosophie und Physik und führt ein journalistisch-akademisches Doppelleben. Als Philosoph lehrte er an den Universitäten Bern, Zürich, St. Gallen. Als Journalist arbeitete er bis 2001 bei Die Weltwoche. Seither lebt er als Autor und Referent. Bücher: «Die Erotik der Tapete. Verführung zum Denken» (2005), «Des Pudels Fell» (2010). www.ludwighasler.ch
Rolf Lappert wurde 1958 in Zürich geboren und lebt in der Schweiz. Er absolvierte eine Ausbildung zum Grafiker, war später Mitbegründer eines Jazz-Clubs und arbeitete zwischen 1996 und 2004 als Drehbuchautor. Bei Hanser erschienen 2008 der mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnete Roman «Nach Hause schwimmen», 2010 der Roman «Auf den Inseln des letzten Lichts», 2012 der Jugendroman «Pampa Blues», 2015 der Roman «Über den Winter» sowie 2020 sein neuer Roman «Leben ist ein unregelmäßiges Verb».

Lesung und Gespräch
Moderation: Julia Knapp
GZ Hottingen, Hottingersaal

12. Januar 2022
Karin Peschka
Lesung und Gespräch
Moderation: Elisabeth Boner
GZ Hottingen, Hottingersaal
Karin Peschka wurde 1967 in Eferding, Oberösterreich, geboren und lebt seit 2000 in Wien. Sie studierte an der Linzer Sozialakademie und arbeitete unter anderem mit alkoholkranken Menschen und arbeitslosen Jugendlichen. Zudem war sie mehrere Jahre im Bereich Onlineredaktion und Projektorganisation tätig. Die Autorin publizierte in diversen Anthologien, schrieb zum Beispiel Kolumnen für die Webseiten von Ö1 (oe.1.ORF.at) und veröffentlichte vier Romane. Ihr Debütroman «Watschenmann» wurde 2019 für die Bühne adaptiert und im Wiener Volkstheater aufgeführt. Für ihr Romanprojekt «Dragan» erhielt sie 2020 das renommierte Musil-Langzeitstipendium. Der Held dieses Romanprojekts ist der Serbe Dragan, ein Boxer, den die Leser im «Watschenmann» bereits kennen.
Karin Peschka bleibt ihren Helden treu. Denn nicht nur Dragan kommt wieder, auch Fanni bleibt. In «FanniPold» schält sie sich, damals gut 30 Jahre alt, nach einer vorgetäuschten Krankheit aus dem spießbürgerlich Dorf-Geschehen heraus. In «Putzt euch, tanzt, lacht» ist Fanni nicht nur gealtert (57 Jahre), sondern bereit für noch radikalere, alternative Lebensentwürfe, denn auch die Heldenreise ist auch eine Art von Flucht.
In ihren Romanen schreibt Karin Peschke atmosphärisch dichte Texte. Sie berichtet, erzählt und schildert. Ihre knappen, aber genauen Milieubeschreibungen und Figuren überzeugen. Ebenso wie ihre Dialoge, die ohne Floskeln der lokalen gesprochenen Sprache folgen.
«Putzt euch, tanzt lacht», Roman, Otto Müller Verlag, Salzburg 2020; «Autolyse Wien. Erzählungen vom Ende», Otto Müller Verlag, Salzburg 2017; «Fannipold», Roman, Otto Müller Verlag, Salzburg, 2016; «Watschenmann», Roman, Otto Müller Verlag, Salzburg 2014
Foto: © Kurt Kaindl

8. Dezember 2021
Simon Deckert
«Siebenmeilenstiefel»
Lesung und Gespräch
Moderation: Felix Ghezzi
GZ Hottingen, Hottingersaal
Andrea stellt sich vor, auf dem Rücken eines Drachens über ihrem Dorf zu fliegen. Sie ist Anfang zwanzig, ihre Mutter hat die Familie vor zehn Jahren verlassen, der alkoholabhängige Vater bezieht Invalidenrente. Über solche Dinge wird zu Hause lieber geschwiegen, und Andrea erfährt am eigenen Leib: Wer über alte Geschichten nicht spricht, der wird sie auch nicht los.
Für ihren Bruder Michl, der lieber Rockmusiker als ein dorfbekannter Schulversager wäre, denkt Andrea sich eine Fluchtgeschichte aus. Als sie ihren Vater und seine Schwägerin bei einem Annäherungsversuch erwischt, merkt sie: Michls Fluchtgeschichte muss auch ihre eigene werden. Zwei Tage später sitzen die Geschwister im Pick-up des Onkels und suchen das Weite.
Andrea erzählt, erinnert, und sie erfindet. So auch eine kühnere Version ihrer selbst namens Ariane, die sie ermutigt, im wirklichen Leben über sich hinauszuwachsen – wenn sie sich, einmal in Basel, auf die Suche macht nach dem, was von ihrer Familie übrig ist. Und ein junger Mann namens Bastian auf dem Fahrrad um die Ecke kommt.
Simon Deckert, Jahrgang 1990, wuchs in Liechtenstein in einer österreichischen Familie auf und lebt heute in St. Gallen. Nach zwei Semestern Anglistik und Philosophie wechselte er 2009 ans Schweizerische Literaturinstitut in Biel, wo er 2013 abschloss. Es folgte ein Schreibstipendium des österreichischen Ministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur in Wien. 2014–2017 absolvierte er den MA Contemporary Arts Practice an der Hochschule der Künste Bern. Seine Texte wurden in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht; neben dem Schreiben ist er als freier Lektor und Mentor sowie als Musiker tätig. «Siebenmeilenstiefel» ist sein erster Roman.
Foto: © Claudia Breitschmid
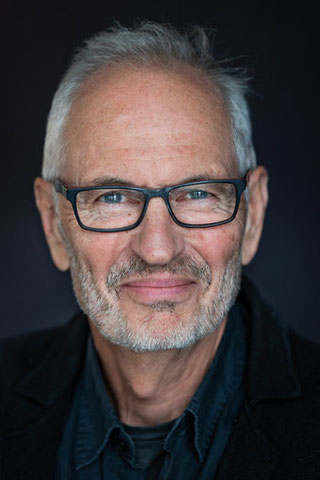
24. November 2021
Eugen Ruge
« Metropol»
Moderation: Ralph Müller
GZ Hottingen, Hottingersaal
Ein Gespräch mit dem Autor über seine Erfahrungen als Erforscher und künstlerischer Gestalter seiner Familiengeschichte, die eng mit den schlimmsten Phasen der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts verquickt ist. Eugen Ruge liest aus seinem neuen Roman «Metropol».
Am Beispiel seiner Großmutter Charlotte macht Eugen Ruge sichtbar, was Menschen in der Kapsel einer Ideologie und in blindem Vertrauen auf einen skrupellosen Despoten, hier Josef Stalin, zu glauben imstande sind. Und wie sie Zweifel, die manchmal trotzdem in ihnen aufsteigen, niederringen: Indem sie den Fehler bei sich selber suchen und sich so gegen die offensichtliche Willkür und Perfidie immunisieren.
Eugen Ruge, geboren am 24. Juni 1954 in Soswa (Ural, Sowjetunion), aufgewachsen in der DDR. Mathematikstudium, Tätigkeit am Zentralinstitut für Physik der Erde, Potsdam. Seit 1985 freier Autor, 1988 Übersiedelung in die Bundesrepublik. Übersetzungen meh- rerer Tschechow-Stücke, Autor für Theater, Funk und Film. 2011 ausserordentlich erfolgreiches Debüt als Romanautor mit In Zeiten des abnehmenden Lichts. Eugen Ruge lebt in Berlin und auf Rügen.
Foto: © Asja Caspari mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Verlages.
8. September 2021
Annette Kopetzki
Zwischen den Sprachen: Von Pasolini bis Camilleri
Ein Abend rund um das Thema des Literarischen Übersetzens
Gespräch
Moderation: Jacqueline Aerne
GZ Hottingen, Hottingersaal
Annette Kopetzki war Dozentin für Deutsche Literatur und Sprache in Italien und Lehrbeauftragte am literaturwissenschaftlichen Seminar der Uni Hamburg. Sie hat lange in Rom gelebt und übersetzt seit 30 Jahren italienische Belletristik und Lyrik, u.a. Pier Paolo Pasolini, Edmondo De Amicis, Andrea Camilleri, Erri De Luca, Alessandro Baricco, Antonella Anedda und Roberto Saviano. 2019 erhielt sie den Paul-Celan-Preis für literarische Übersetzung. Außerdem veröffentlicht sie Beiträge zur Theorie und Praxis des Übersetzens in Zeitschriften und Lexika und engagiert sich im Verein „Weltlesebühne“ für die Sichtbarkeit der Übersetzer*innen, ohne die es keine Weltliteratur gäbe, wie José Saramago sagte.
Stimmen des Südens: eine Übersetzung zum Sprechen bringen
Wer übersetzt, lebt und arbeitet zwischen zwei Sprachen. Im Zwischenraum der Sprachen, d.h. bevor ein Buch in einer anderen Sprache vorliegt, sind Übersetzer*innen einer Reihe irritierenden Fragen ausgesetzt: wie behalte ich Rhythmus und Klang bei? Was passiert mit der Satzstruktur? Was passiert mit dem Reim? Wie verwandelt sich ein Text auf seiner Reise in eine andere Sprache und Kultur? In den letzten Jahren beobachtet man eine starke Zunahme dialektaler Ausdrücke in der italienischen Literatur, was angesichts der vielen Dialekte der Halbinsel eine ganz besondere Herausforderung für Literaturübersetzerinnen darstellt. Kann die Übersetzung sizilianische, neapolitanische und römische Stimmen auf Deutsch erklingen lassen? Was muss eine Übersetzerin tun, um dem Original treu zu bleiben und die lokale Färbung zu bewahren? Hilft der Kontakt mit dem Autor? Wie geht man mit Redewendungen oder Sprichwörtern um?
Anhand anschaulicher Beispiele gab Annette Kopetzki Einblick in ihre Arbeit als Übersetzerin.
13. Oktober 2021
Jonas Lüscher
«Der populistische Planet - Berichte aus einer Welt in Aufruhr»
Lesung und Gespräch
Moderation: Josef Estermann
GZ Hottingen, Hottingersaal
Populisten auf der ganzen Welt erzählen dasselbe. Der Staat befinde sich in der Hand einer abgehobenen, urbanen Elite, welche die Globalisierung vorantreibe. Sie habe den Kontakt zu den «normalen» Bürger*innen längst verloren und könne die alltäglichen Sorgen des Volkes nicht mehr nachvollziehen. Sie jedoch gehörten nicht zu dieser Elite. Sie würden die Ängste der Büger*innen verstehen, offen ansprechen und ernst nehmen.
Der Schriftsteller Jonas Lüscher hat zusammen mit dem Philosophen Michael Zichy einen Briefwechsel herausgegeben. Er versammelt Briefe von Journalist*innen, Philosoph*innen, Schriftsteller*innen und Aktivist*innen aus sieben Ländern: Indien, Ägypten, Brasilien, Kenia, Russland, Ungarn, Österreich und der Schweiz. Sie kreisen alle um den Populismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen.
Jonas Lüscher und Michael Zichy fragen, warum es Politikern wie Christoph Blocher, Trump und Berlusconi gelingt, bei vielen als volksnah zu gelten; warum ihnen nicht wenige abnehmen, sich um die Sorgen der einfachen Leute anzunehmen. Sie fragen, ob die Meinungen und Interessen der vielen wirklich durch eine Elite unterdrückt werden; ob die Populisten tatsächlich die wahren Interessen der «schweigenden Mehrheit» vertreten. Und sie fragen sich selbst, ob sie - die Diskussionsteilnehmer - auch Teil dieser Elite und damit des Problems seien.
Jonas Lüscher wurde 1976 in Schlieren geboren, wuchs in Bern auf, besuchte das Lehrerseminar, arbeitete als Dramaturg und Stoffentwickler in der Münchner Filmwirtschaft und als freiberuflicher Lektor. Jonas Lüscher lebt in München.
Lüscher studierte Philosophie in München, war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Technik-Theologie-Naturwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität, wechselte an die ETH Zürich und die Stanford University und schrieb an einer Dissertation über die Bedeutung von Erzählungen für die Beschreibung sozialer Komplexität.
Er wurde für seine Novelle «Frühling der Barbaren» und seinen Roman «Kraft» für den Deutschen und den Schweizer Buchpreis nominiert, erhielt für «Frühling der Barbaren» neben weiteren Auszeichnungen den literarischen Preis des Kantons Bern und den Bayrischen Kunstförderpreis und für «Kraft» u.a. den Schweizer Buchpreis und den Tucan-Preis.
12. Mai 2021
Peter K. Wehrli
«Agenda für immer»
Lesung und Gespräch
Moderation: Sepp Estermann
GZ Hottingen, Hottingersaal
[Wegen Corona: Nach den Vorschriften des Bundesrates durften dem Anlass nicht mehr als 50 Personen beiwohnen. Die Bestuhlung gewährleistet die nötige Distanz. Für das Publikum besteht eine Maskenpflicht.]
Unterwegs im Orient-Express zwischen Zürich und Beirut merkte Peter K. Wehrli im Jahr 1968, dass er seinen Fotoapparat zu Hause vergessen hatte. Er wusste sich zu helfen: Er fasste alles, was ihm bemerkenswert schien, in Worte. Und so entstand ein Katalog aller jener Dinge, die er fotografiert hätte, wenn er die Kamera bei sich gehabt hätte. Diesem Festhalten seiner Beobachtungen in kurzen Notizen oder Nummern blieb er treu, und die Sammlung aller Nummern wurde zu seinem «Katalog von Allem», den er nunmehr seit über 50 Jahren pflegt und fortsetzt. Aus dem auf 2222 Katalognummern angewachsenen «Work in Progress» hat Wehrli einen Jahreskalender von 365 Nummern erstellt, die «Agenda für Immer». Dabei hat er die meisten seiner «geschriebenen Fotografien» jenen Tagen im Jahr zugeordnet, an denen sich das Geschilderte zugetragen hatte. Der «Katalog von Allem» ist mittlerweile in vielerlei Gestalt und in mehreren Ausgaben als Buch und Hörbuch erschienen, zuletzt in amerikanischer Fassung als «Catalog of Everything and Other Stories» im Verlag der University of California Berkeley.
Peter K. Wehrli, 1939, Schriftsteller und Filmemacher, studierte Kunstgeschichte und Literatur in Paris und Zürich. Das Zusammenspiel von Fremdem und Vertrautem zieht sich als Grundton durch sein literarisches Schaffen, in dessen Zentrum seit 50 Jahren der wachsende «Katalog von Allem» steht.
Zu den bisherigen Auszeichnungen gehören unter anderen der ZKB-Schillerpreis und die Goldene Ehrenmedaille des Kantons Zürich. Peter K. Wehrli war bis vor Kurzem Vizepräsident des eurobrasilianischen Kulturzentrums «Julia Mann» in Paraty, Brasilien.

17. März 2021
Karl Rühmann
«Der Held»
Lesung und Gespräch
Moderation: Julia Knapp
[Wegen Corona fand die Veranstaltung live online via Zoom statt.]
2005, in einem Land, in dem von 1990–1995 ein Bürgerkrieg getobt hat: Zwei hohe Offiziere, die einst in derselben Armee gedient, im Krieg aber auf verschiedenen Seiten gekämpft hatten, werden als Kriegsverbrecher angeklagt und an das Internationale Tribunal in Den Haag ausgeliefert. Dort freunden sie sich an, da sie Vieles verbindet: die Vergangenheit, die Sprache, das Alter, nicht zuletzt die drohende Strafe. Der General der siegreichen Partei wird nach fünf Jahren Untersuchungshaft freigesprochen, der Oberst der unterlegenen Partei zu einer langjährigen Strafe verurteilt.
Die Männer schreiben einander Briefe, um die vergangenen Ereignisse einzuordnen und Szenarien für die Zukunft zu entwickeln. Ihre Gedanken kreisen um Schuld und Unschuld, Justiz und Gerechtigkeit. Die Briefe sind Ausdruck der Freundschaft zweier Menschen, die erst im Gefängnis gemerkt haben, dass sie mehr verbindet als trennt.
Ana lebt mit ihrem 12-jährigen Sohn nahe dem Dörfchen, in dem sich der General zur Ruhe gesetzt hat. Anas Mann, ein überzeugter Patriot, hat sich gemäss den Aussagen der Armee 1993 das Leben genommen. Als sich der General, den Ana sehr verehrt, nun in ihrer Nähe niederlässt, bietet sie ihm an, seinen Haushalt zu führen. Heimlich liest sie die Briefe der beiden alten Soldaten und erschrickt, als der Oberst ein Blutbad erwähnt, an dem der General schuld sein soll. Möglicherweise hat er sogar Anas Mann auf dem Gewissen. Ana steht vor einem Dilemma: Wenn sie sich gegen den General wendet, wird sie die Öffentlichkeit gegen sich aufbringen. Denn in dieser instabilen Zeit profitieren viele von einem Helden, den sie für ihre Zwecke nutzen können.
Karl Rühmann wurde 1959 in Jugoslawien geboren und wuchs dort auf. Er studierte Germanistik, Hispanistik und Allgemeine Literaturwissenschaft in Zagreb und Münster und war Sprachlehrer und Verlagslektor. Heute lebt er in Zürich als Literaturübersetzer und Autor von Romanen, Hörspielen und zahlreichen, international erfolgreichen Kinderbüchern.
Sein Roman «Der Held» war nominiert für den Schweizer Buchpreis 2020. Für seinen ersten Roman «Glasmurmeln, ziegelrot» wurde Karl Rühmann 2015 mit dem Werkjahr der Stadt Zürich ausgezeichnet.
Foto: © Franz Noser

9. Dezember 2020
Barbara Vinken
Die Mode in der Literatur
Gespräch und Lesung
Moderation: Julia Knapp, mit Martine Grossjean und Barbara Wanlger
GZ Hottingen, Hottingersaal
Die Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken ist eine der bekanntesten Modetheoretikerinnen unserer Zeit. In ihrem Buch „Angezogen. Das Geheimnis der Mode“ , das 2014 in der Kategorie Sachbuch / Essayistik für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert wurde, beschreibt Barbara Vinken wechselnden Moden als ein differenziertes Zeichensystem, das die kulturellen und gesellschaftspolitischen Bedingungen der Geschlechter widerspiegelt und in ihrem Ausdruck sogar noch verstärkt.
Im Literarischen Club Zürich erzählte Barbara Vinken über Mode als Stilmittel in der Literatur, wie der Rock als Merkmal des Charakters beschrieben wird; das Kostüm als Symbol für einen Gemütszustand; den Anzug als Definition eines Eindrucks, den ein Mensch auf den anderen ausübt – Autorinnen und Autoren verwenden Mode oft als Stilmittel zur Charakterisierung ihrer Figuren.
Barbara Vinken sprach unter anderem über Texte von Gustave Flaubert, Charles Beaudelaire, Marcel Proust, Vicky Baum und Gottfried Keller. Das Gespräch fand auf Deutsch statt, kurze Textbeispiele wurden in der jeweiligen Originalsprache (deutsch, italienisch, französisch) vorgetragen.
7. Oktober 2020
Lieblingsbücher
Der Vorstand des Literarischen Clubs Zürich präsentiert seine Lieblingsbücher
Moderation: Urs Heinz Aerni
GZ Hottingen, Hottingersaal
Mit dabei in alphabetischer Reihenfolge:
Jacqueline Aerne
Elisabeth Bohner
Josef Estermann
Felix Ghezzi
Martine Grosjean Greiner
Julia Knapp
Ralph Müller
Waltraud Schram
Barbara Wangler (war verhindert)
Diese Bücher wurden empfohlen, vorgestellt und besprochen:

9. September 2020
Ariela Sarbacher
«Der Sommer im Garten meiner Mutter»
Lesung und Gespräch
Moderation: Felix Ghezzi
GZ Hottingen, Hottingersaal
Der erste Roman der Schauspielerin Ariela Sarbacher erzählt in einer kräftigen, klaren und poetischen Prosa eine Familiengeschichte, die sich fast über ein ganzes Jahrhundert erstreckt. Leidenschaftliche, mediterran angehauchte Italianità im Wechselspiel mit nüchtern schweizerischem Erzählton.
Es ist ein vier Wochen langer kurzer Sommer, in dem Mutter und Tochter sich voneinander verabschieden. Konfrontiert mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit und dem Entscheid der Mutter, selbstbestimmt in den Tod zu gehen, begibt sich die Tochter Francesca auf Spurensuche.
Von Chiavari, einem Städtchen an der ligurischen Küste, wo die Mutter in den Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts geboren wurde, führt die Erinnerung nach Zürich, in ein Vorstadtquartier, wo die Tochter Francesca ihre Jugend in den Sechzigerjahren erlebt hat. «Der Sommer im Garten meiner Mutter» handelt vom Vergehen. Schön wie ein Sonnenuntergang am Ligurischen Meer erzählt, lesen wir einen Roman, der das Leben der Mutter und all jener Menschen, die davon berührt wurden, auf stimmige Art erinnert; der aber auch die Geschichte einer Tochter erzählt, die erst nach oft schmerzhaften Reisen in die Gärten der Erinnerung eines gemeinsamen Lebens loslassen kann.
Ariela Sarbacher wurde 1965 in Zürich geboren. An der Schauspiel-Akademie Zürich wurde sie als Schauspielerin ausgebildet. Ihre ersten Engagements führten sie ans Stadttheater Heidelberg und an die Bremer Shakespeare Company. Nach der Geburt ihrer beiden Töchter liess sie sich zur Taiji-, Qi Gong- und Pilateslehrerin ausbilden. 2002 gründete sie ihre Schule «Einfluss». Sie hat ein eigenes Präsenztraining entwickelt, mit dem sie Menschen für ihre Auftritte vor Publikum vorbereitet. Von 2017–2018 Ausbildung Literarisches Schreiben am EB Zürich. Heute arbeitet sie als Schriftstellerin, Sprecherin, Schauspielerin und Präsenztrainerin.
Foto: © Janine Guldener

[11. März 2020 - Ausfall wegen Corona, Verschoben auf 24. November 2021]
Eugen Ruge
«Metropol»
Moderation: Ralph Müller
GZ Hottingen, Hottingersaal
Ein Gespräch mit dem Autor über seine Erfahrungen als Erforscher und künstlerischer Gestalter seiner Familiengeschichte, die eng mit den schlimmsten Phasen der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts verquickt ist. Eugen Ruge liest aus seinem neuen Roman «Metropol».
Am Beispiel seiner Großmutter Charlotte macht Eugen Ruge sichtbar, was Menschen in der Kapsel einer Ideologie und in blindem Vertrauen auf einen skrupellosen Despoten, hier Josef Stalin, zu glauben imstande sind. Und wie sie Zweifel, die manchmal trotzdem in ihnen aufsteigen, niederringen: Indem sie den Fehler bei sich selber suchen und sich so gegen die offensichtliche Willkür und Perfidie immunisieren.
Eugen Ruge, geboren am 24. Juni 1954 in Soswa (Ural, Sowjetunion), aufgewachsen in der DDR. Mathematikstudium, Tätigkeit am Zentralinstitut für Physik der Erde, Potsdam. Seit 1985 freier Autor, 1988 Übersiedelung in die Bundesrepublik. Übersetzungen meh- rerer Tschechow-Stücke, Autor für Theater, Funk und Film. 2011 ausserordentlich erfolgreiches Debüt als Romanautor mit In Zeiten des abnehmenden Lichts. Eugen Ruge lebt in Berlin und auf Rügen.
Foto: © Asja Caspari mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Verlages.

12. Februar 2020
Johanna Lier
»Wie die Milch aus dem Schaf kommt«
Lesung und Gespräch
Moderation: Julia Knapp und Felix Ghezzi
GZ Hottingen, Hottingersaal
Selma Einzig macht in der Hinterlassenschaft ihrer Grossmutter Pauline einen schockierenden Fund. Aus ihrem Alltag herausgerissen macht sich die 35-jährige Protagonistin auf die Suche nach verdrängten Teilen ihrer Familiengeschichte. Sie führt sie in die Ukraine und nach Israel.
Wer waren die papier- und mittellosen Vagabunden, die aus dem Gebiet der heutigen Ukraine in den Thurgau flüchteten und im kleinen Weiler Donzhausen die erste Nudelfabrik in der Ostschweiz gründeten?
Die Reise führt aus dem Vergessen und Verdrängen zu Orten der Selbstentdeckung. Das Erfinden von Erinnerungen, das Fabulieren, aber auch das Erforschen der Gegenwart und Zufallsbekanntschaften erweisen sich als überraschende Mittel, um Lücken zu füllen. Eine Suche nach der eigenen Herkunft, die höchst ambivalent bleibt und mitunter auch von einem verstörenden Unbehagen begleitet wird. Die Erkenntnis, dass sich im Grunde nichts ändert, man lediglich ein Stück seines Wegs gegangen ist, lässt Selma Einzig ihr Vorhaben am Rand eines Kraters in der Wüste Negev in Rauch aufgehen.
Der Bericht ist eine abenteuerliche Reise in einer globalen Gegenwart. Und ein Stück überraschender Industrie- und Migrationsgeschichte aus der Schweiz des 19. Jahrhunderts.
Johanna Lier studierte Schauspiel in Bern und absolvierte einen Master of Arts in Fine Arts in Zürich. Sie lebt als Dichterin und freie Journalistin in Zürich. Nach jahrelanger Tätigkeit als Schauspielerin arbeitete sie als Redakteurin bei der Wochenzeitung WoZ. Sie veröffentlichte zahlreiche Gedichtbände und zwei ihrer Theaterstücke wurden uraufgeführt. Recherchen und politische Projekte führten sie für längere Zeit in den Iran, die Ukraine, nach Nigeria, Chile, Israel, Argentinien und Griechenland. Sie unterrichtet kreatives Schreiben an der Kunsthochschule Luzern und ist im JULL, junges Literaturlabor mit Jugendlichen, literarisch unterwegs. »Wie die Milch aus dem Schaf kommt« ist ihr erster Roman im Verlag die Brotsuppe.

8. Januar 2020
Christian Lorenz Müller
Lesung und Gespräch
Moderation Elisabeth Boner
GZ Hottingen, Hottingersaal
Sein Debut «Wilde Jagd» ist eine Art Anti-Heimatroman. Müller porträtiert den jungen sensiblen Bauern und Maskenschnitzer Emmeran. Dieser ist ein Eigenbrötler, der lieber seine Stallarbeit macht oder allein im Wald arbeitet, statt zu reden. Der schwere Arbeitsunfall seines Neffens wirft ihn plötzlich aus der Bahn und sein Schweigen muss enden.
In seinen zweiten, facettenreicheren Roman «Ziegelbrennen» thematisiert Müller eine Familiengeschichte aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Erzählstränge beginnen mit der Zeit der faschistischen Ustascha-Diktatur in Kroatien während des Zweiten Weltkriegs und enden im Heute. Vertreibung, Flucht und Spurensuche bilden ein Mahnmal gegen das Vergessen.
Christian Lorenz Müller wurde 1972 in Rosenheim, Bayern, geboren und lebt als Schriftsteller und Literaturvermittler in Salzburg. Nach einer Lehre zum Trompetenmacher verbrachte er einige Gesellen- und Reisejahre in St. Gallen, Linz und München. Er schreibt Prosa und Lyrik. Neben dem Schreiben rezensiert Müller für die Zeitschrift «Literatur und Kritik», den «poetenladen.de», «fixpoetry.com» und die Salz- burger Nachrichten. Zudem ist er Stammautor des Lyrikblogs «der-goldene-fisch.de» und Prosaredakteur der deutschen Literaturzeitschrift «Konzepte» (konzepte-zeitschrift.de). Auszeichnungen: Bayrischer Kunstförderpreis 2012 Grenzgänger-Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung 2012, Würdigungsstipendium der LiterartMechana Wien 2012, Georg-Trakl-Förderungspreis für Lyrik 2012, Stadtschreiber von Schwaz in Tirol 1999.
Foto: © Johannes Amersdorf

13. November 2019
Maike Albath
Zum hundertsten Geburtstag von Primo Levi
Vortrag und Gespräch
Moderation: Jacqueline Aerne
GZ Hottingen, Hottingersaal
Zu Primo Levi
Ein wackliger Tisch, eine zugige Laborecke, etwas Zeit während der Mittagspause und ein Schulheft – mehr brauchte der Chemiker Primo Levi nicht, um sein erstes Buch zu schreiben. Er war 26 Jahre alt und hatte Ausschwitz überlebt. «Ist das ein Mensch?» nannte er sein autobiographisches Zeugnis, das innerhalb weniger Wochen entstand. «Das Buch wuchs fast spontan unter meinen Händen, wie ein Termitenhügel», sagte er später. Er war als Jude und Widerstandskämpfer deportiert worden und entging den Gaskammern, weil er im Labor arbeitete. Aber der Turiner Verlag Einaudi, eigentlich die richtige Adresse für engagierte Literatur, lehnte das Manuskript ab: Italien war mit dem Wiederaufbau beschäftigt, man wollte nach vorne schauen und höchstens von glorreichen Partisanenkämpfen etwas hören. Schließlich erschien Levis Erfahrungsbericht im Herbst 1947 in einem Kleinverlag. Elf Jahre später kam das Buch dann doch noch bei Einaudi heraus – und zählte bald zur Weltliteratur. Von nun an war Primo Levi hochgeschätzt, veröffentlichte Romane, Erzählungen und Zeitungsartikel. Seine Auflagen schnellten in die Höhe, er wurde international berühmt und mit Preisen ausgezeichnet. Aber der zurückhaltende Turiner blieb ein Zentaur, wie er sich selbst einmal bezeichnete: Geschäftsführer einer Chemiefabrik und Schriftsteller. Erst Ausschwitz habe ihn zum Erzähler gemacht. Im Frühjahr 1987 nahm sich Primo Levi das Leben.
Maike Albath studierte Romanistik und Germanistik an der Freien Universität Berlin und an der Università degli Studi in Padua. In ihrer Dissertation (1996) befasste sie sich mit dem zeitgenössischen Dichter Andrea Zanzotto, einem der bedeutendsten und zugleich schwierigsten Lyriker der italienischen Gegenwartsliteratur. Seit 1993 arbeitet Maike Albath als Journalistin beim «Deutschlandfunk» im Bereich Kultur. Ihre Literaturkritiken erscheinen in der «Süddeutschen Zeitung» und der Wochenzeitung «Die Zeit».
Neben einer Vielzahl von Sendungen über das literarische Italien entstanden in den letzten Jahren mehrere Bücher. Ihr besonderes Interesse gilt der italienischen Geistes- und Kulturgeschichte. 2010 erschien Der Geist von Turin. Pavese, Ginzburg, Einaudi und die Wiedergeburt Italiens nach 1943 über die Gründung des Verlagshauses Einaudi. Um das Rom der 1950er- und 1960er-Jahre drehte sich der Band «Rom, Träume. Moravia, Pasolini, Gadda und die Zeit der Dolce Vita» (2013). Dass Sizilien literarisch wegweisend war, steht im Mittelpunkt ihres gerade erschienenen Buches «Trauer und Licht. Lampedusa, Sciascia, Camilleri und die Literatur Siziliens» (2019). Ihr aktuelles Projekt hat Neapel zum Gegenstand. Vermitteln Matilde Seraõ, Annamaria Ortese, Wanda Marasco und Ermanno Rea die Stadt als einen unbezwingbaren Körper oder als einen analysierbaren Raum? Welche Topoi nehmen die international erfolgreichen Neapel-Romane von Elena Ferrante auf? Welche Folgen haben die Verfilmungen der Bücher von Roberto Saviano und Elena Ferrante für die Selbstinszenierung der Stadt? Maike Albath ist im Oktober 2019 journalist Fellowan der Bibliotheca Hertziana.
Foto: © Enrico Fontolan, Bibliotheca Hertziana

9. Oktober 2019
Maja Haderlap
Lesung und Gespräch
Moderation: Josef Estermann
GZ Hottingen, Hottingersaal
«Engel des Vergessens» (Roman)
«Langer Transit» (Lyrik)
«Im langen Atem der Geschichte» (Rede zur Hundertjahrfeier der Republik Österreich)
Textauszüge aus «Engel des Vergessens»
«Eiermädchen, nennt mich Grossmutter. Den Namen habe mir Grossvater gegeben, erzählt sie, als er krank auf der Ofenbank lag und auf mich achtgeben musste. Ich sei ein Schosskind gewesen, kaum mehr als ein Jahr alt, und habe die Eier in der untersten Lade der Stubenkredenz entdeckt, sie einzeln über den Holzboden rollen lassen und, sobald das Eigelb aus der Schale getreten war, sonci gre gerufen, dass Sonnchen geht auf. Grossvater habe mich beobachtet und sei so begeistert gewesen, dass er mich die Schüssel ausräumen liess und ihr verboten habe, mit mir zu schimpfen. Er habe gemeint, während sie die Eierspeise vom Boden aufwischte, dass man mit mir und mit ihm Mitleid haben müsse. Bald danach sei er gestorben, obwohl ich ihn unterhalten hätte.» (S. 8/9)
Maja Haderlap wurde 1961 in Eisenkappel / Zelezna Kapla (Österreich) geboren. Sie entstammt einer in Kärnten beheimateten slowenischen Familie, studierte Theaterwissenschaft und Germanistik an der Universität Wien und war von 1992 bis 2007 Chefdramaturgin am Stadttheater Klagenfurt. Sie lebt als freie Schriftstellerin in Klagenfurt und unterrichtet an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Maja Haderlap veröffentlichte Gedichtbände auf Slowenisch und Deutsch und Übersetzungen aus dem Slowenischen. Für den «Engel des Vergessens» erhielt sie unter anderem den Ingeborg-Bachmann-Preis, den Rauriser Literaturpreis für das beste Romandebüt, den Prix du Premier roman etranger und letztes Jahr den Max-Frisch-Preis der Stadt Zürich.
Foto: © Max Ammann / Wallstein Verlag

11. September 2019
Regine Dieterle
Theodor Fontane (Biographie)
Lesung und Gespräch
Begrüßung: Martine Grosjean
Moderation: Ralph Müller
200 Jahre Theodor Fontane - Regina Dieterles große neue Biografie liefert ein lebendiges Panorama des 19. Jahrhunderts. Zu seinem 200. Geburtstag widmet Regina Dieterle Theodor Fontane eine umfassende Biografie. Lebendig, anschaulich und auf der Grundlage jüngster Recherchen zeichnet sie ein zeitgemäßes Bild des scheinbar vertrauten Autors, der zu den großen europäischen Romanciers des 19. Jahrhunderts zählt. Neben den Romancier tritt nun der Reiseschriftsteller und Journalist. Wechselseitig betrachtet, werden die engen Verbindungen zwischen dem literarischen und dem journalistischen Werk deutlich. Das wirft nicht nur ein neues Licht auf Fontanes Arbeitsweise, sondern verändert auch unsere Lektüre der Romane. Regina Dieterles Biografie öffnet die Augen für ein staunenswertes Werk.
Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter des großen europäischen Romans auch Theodor Fontane lesen und entdecken wir bis heute immer wieder neu. Zu seinem 200. Geburtstag widmet ihm Regina Dieterle eine umfassende Biografie. Lebendig, anschaulich und auf der Grundlage jüngster Recherchen erzählt, zeichnet sie ein zeitgemäßes Bild des scheinbar vertrauten Romanciers, Reiseschriftstellers und Journalisten. Das wirft nicht nur ein neues Licht auf Fontanes Arbeitsweise, sondern verändert auch unsere Lektüre der Romane. Egal, ob einen Fontane schon viele Jahre begleitet oder ob man ihn erst kennenlernen will: Regina Dieterles Biografie öffnet die Augen für ein staunenswertes Werk.
Regina Dieterle, geboren 1958 in Horgen, Germanistin, studierte und promovierte an der Universität Zürich. Sie unterrichtet an der Kantonsschule Enge in Zürich. Seit 1998 regelmäßige Forschungsaufenthalte in Berlin und Brandenburg, unterstützt vom SNF (Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung). Entdeckte 2001 den Nachlass von Martha Fritsch-Fontane. Ab 2004 für zehn Jahre Vorstandsmitglied der Theodor Fontane Gesellschaft, 2010 bis 2014 als deren Vorsitzende. Publikationen zu Leben und Werk von Annemarie Schwarzenbach, Karl Stauffer-Bern, Theodor Fontane und Martha Fontane. Bei Hanser erschienen zuletzt: «Die Tochter. Das Leben der Martha Fontane» (2006) und «Theodor Fontane. Biografie» (2018).
Foto: © Willi-Peter Hummel, Quelle: Carl Hanser Verlag München

10. April 2019
Melinda Nadj Abonji
«Im Schaufenster im Frühling»
«Tauben fliegen auf»
«Schildkrötensoldat»
Lesung und Gespräch
Moderation: Josef Estermann
GZ Hottingen, Hottingersaal
Textauszug aus «Schildkrötensoldat»:
«Man hat Jenö man hat ihn an meinen Rucksack gebunden, nach zwei Kilometern, weil er nicht mithalten konnte, bei einem Trainingsmarsch -M-A-R-S-C-H- dem letzten, vor Vukovar
das Spiel, bald wird es ernst! so der Raubvogel
ja, sie haben Jenö mit Riemen liessen der Kommandant und der Leutnant ihn an meinen Rucksack festbinden, von seinen Traggurten aus an meinen Rucksack -R-Ü-C-K-E-N- Marschrekord! der Kommandant und der Leutnant wollten einen neuen Rekord aufstellen
Kertész, du hast die Verantwortung für deinen Fettsack im Schlepptau, verstanden? jetzt kannst du ihm helfen!
Jenö lachte oder lächelte, er und ich, wir mussten vorne marschieren, hinter dem Kommandanten und dem Leutnant, und die Truppe, vierundzwanzig Mann, hinter uns
ein Morgen so frisch wie das Wasser im Gesicht
-S-P-Ä-T-S-O-M-M-E-R-
-F-R-Ü-H-H-E-R-B-S-T-
Tage, an denen sich die Jahreszeiten kreuzen, ein Tag, an dem man doch sitzen und den Tag, die aufgehende Sonne bewundern müsste
Kertész, Zigeunerfratze, Schlappschwanz, du hast die Verantwortung für deinen Fettsack im Schlepptau! so der Leutnant vor uns
oh, ich werde diesen Satz nie vergessen, nicht wegen Zigeunerfratze oder Schlappschwanz, nicht wegen Fettsack, sondern wegen Verantwortung
-V-E-R-A-N-T-W-O-R-T-U-N-G-
Kertész, du erleichterst ihm das Marschieren im eingeschlagenen Tempo!
ich habe nicht widersprochen, nein, niemand hat widersprochen, wir waren alle, alle waren wir ein einziger Antrieb, und Jenö und ich haben mitgehalten, am Anfang, wir haben sogar ein Lied gesungen, das ich ihm beigebracht habe, über das er immer gespottet hat
‹eine Knospe war ich, als ich geboren wurde, eine Rose, als ich Soldat wurde, im eigenen Dorf, da bin ich aufgeblüht, in der Kaserne, da bin ich verwelkt ...›
und der Leutnant, er hat gelacht, das ist das falsche Lied, ihr Waschlappen! und er stimmte sein Lieblingslied an, "ich marschier zu dir, ich marschier zu dir, vorn und hinten, gut bestückt, leck ich dich wund, zu jeder Stund"
nach drei Kilometern hat Jenö nur noch laut gekeucht, ich habe ihm zugeredet, ihn mein Habundgut genannt, meinen liebsten Anhänger, ich habe ihm gut zugeredet, obwohl reden und marschieren anstrengend ist, aber ich habe es getan, damit er weiss, damit er weiss, dass ich da bin, Jenö hat nicht geantwortet, und ich bin kurz stehengeblieben, habe ihm den Rucksack abgenommen.»
Melinda Nadj Abonji wurde 1968 in der Vojvodina geboren. Sie entstammt einer ungarischen Familie und verbrachte ihre ersten Jahre bei ihrer Grossmutter in Jugoslawien. Im fünften Altersjahr kam sie zu ihren Eltern in die Schweiz. Melinda Nadj Abonji studierte in Zürich Germanistik und Geschichte und erwarb 1997 das Lizentiat. Sie lebt als Schriftstellerin und Musikerin in Zürich. Melinda Nadj Abonji debütierte 2004 mit dem Roman «Im Schaufenster im Frühling» im Ammann-Verlag. 2010 erschien «Tauben fliegen auf» im Jung und Jung-Verlag in Salzburg und Wien. Melinda Nadj Abonji erhielt dafür sowohl den Deutschen als auch den Schweizer Buchpreis. 2017 erschien 'Schildkrötensoldat» bei Suhrkamp. Er wurde mit dem Schillerpreis der ZKB ausgezeichnet. «Tauben fliegen auf» wurde bisher in neunzehn Sprachen übersetzt.
Foto © Gaëtan Bally/Suhrkamp Verlag

20. März 2019
Friedrich Christian Delius
Als die Bücher noch geholfen haben – Die Zukunft der Schönheit
Lesung und Gespräch
Moderation Ralph Müller
GZ Hottingen, Hottingersaal
Ein Gespräch mit dem Autor über seine Erfahrungen als Lektor, Dichter, Zeitzeuge an Wendepunkten der deutschen Geschichte und Gesellschaft seit 1968. F.C. Delius liest aus seinen Erzählungen «Bildnis der Mutter als junge Frau» (2006) und «Die Zukunft der Schönheit» (2018).
«... in Russland sah es nicht mehr nach grossen Siegen aus, man sprach fast nicht mehr von Siegen, man sprach nur noch von der Dauer des Krieges, und was war der grausame Krieg wert, wenn nicht mehr gesiegt wurde, einen Krieg ohne Sieg konnte sie sich nicht vorstellen, seit sie zwölf war, hatte der Führer das Deutsche Reich von einem Sieg zum andern geführt, es war, solange sie denken konnte, immer nur gewonnen, erobert, gefeiert, gejubelt worden, für die politischen und militärischen Erfolge wurde auch in den Gottesdiensten mit Gebeten gedankt, und nur wenn gesiegt würde, könnte ihr Mann schnell zurückkommen, wenn aber an fast allen Fronten noch mehr Niederlagen drohten, bliebe er fort, in immer grösserer Lebensgefahr, und sie müsste länger und länger warten, was sollte aus dem schönen Deutschland werden ohne Siege, das war gar nicht auszudenken, das war verboten zu denken, sie verbat sich das, und während ihre Sehnsucht südwärts nach Afrika flog, tauchte die Wartburg vor ihren Augen auf ...»
Aus: «Bildnis der Mutter als junge Frau»
F.C. Delius versetzt sich in dieser biographisch fundierten Erzählung in die Gedanken seiner Mutter, die schwanger mit ihm, dem künftigen Autor, ihrem Mann Ende 1942 nach Rom gefolgt ist. Dieser, ein zur Wehrmacht eingezogener protestantischer Pfarrer, wird, kaum ist sie in Italien angekommen, nach Afrika versetzt. Die zitierte Passage steht als Beispiel für die Meisterschaft des Dichters, historisch-politische Hintergründe und Zusammenhänge in eine Sprache zu integrieren, die sich wunderbar leicht und genau aus der Situation und dem Fühlen der Protagonistin entwickelt.
Friedrich Christian Delius, geboren am 13. Februar 1943 in Rom, aufgewachsen in Wehrda und Korbach in Hessen. Seit 1963 in Berlin, Studium an der Freien und Technischen Universität, Dr. phil. 1970. Bis 1978 Lektor für Literatur in den Verlagen Klaus Wagenbach und Rotbuch. Prozesse, welche die Siemens AG (1972-76) und Helmut Horten (1979-82) gegen ihn führten, erfolgreich überstanden. Seit 1978 freier Schriftsteller, von 1978-80 in Beek bei Nijmegen/NL, von 1980-84 in Bielefeld. Seitdem lebt er wieder in Berlin (von 2001 bis 2013 in Rom und Berlin). Er erhielt u.a. den Georg-Büchner-Preis 2011 und das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, 2017. Delius ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Akademie der Künste Berlin.
Foto: © Jürgen Bauer - Rowohlt Verlag

27. Februar 2018
Brigitte Giraud
« Un loup pour l’homme »
Lesung und Gespräch
Moderation: Martine Grosjean
in französischer Sprache
GZ Hottingen, Hottingersaal
« Mars 1960
Le médecin parcourt la lettre que lui tend Lila et considère les analyses de sang. Il reste distant, inaccessible derrière ses verres épais. Puis il demande pourquoi cette décision.
C’est abrupt et tranchant.
Lila fait un début de phrase bancal, celui qu’elle a préparé pendant tout le voyage.
Le médecin ne voit aucune raison d’interrompre la grossesse. Elle est en parfaite santé, elle est jeune. Il fait celui qui ne veut pas comprendre. Lila répète que son mari est appelé pour l’Algérie. Mais le médecin ne regarde pas Antoine, cela est déconcertant. Il ne s’adresse qu’à la future mère comme si elle était la seule concernée, comme si Antoine n’était qu’un accompagnateur.
Il n’est pas dans le tempérament d’Antoine de prendre une parole qui ne lui est pas donnée, alors il demeure silencieux, presque honteux. Il ne vient pas au secours de Lila et on peut parier qu’elle lui en voudra. Il tente toutefois de faire remarquer que son père à lui a vécu un drame en quarante, et qu’il préférerait ne pas … Mais le médecin le coupe et dit que l’Algérie, ce n’est pas la même chose qu’une guerre.
Pour mettre un terme à l’entretien, le médecin ajoute, d’un air satisfait, que si toutes les femmes de soldats avaient avorté, la terre serait dépeuplée.
Au retour de Genève, la route est longue sur la Vespa. Lila espère un accident, une chute, des ornières sur la route. Elle voudrait couler, elle pense à tomber, elle se dit qu’elle trouvera un moyen. Accrochée à Antoine, elle abandonne son visage à l’air qui le fouette, elle ne prend garde à rien. Elle veut bien avoir mal, elle préfère souffrir, sentir son dos qui lance des pics, et son ventre qui se crispe à chaque nouvelle accélération. Elle espère que quelque chose va arriver, qui va la délivrer. Elle refuse d’être qui elle est, Lila, vingt-deux ans, un bébé prévu pour l’automne et un mari bientôt confisqué. »
Extrait de « Un loup pour l’homme », éd. Flammarion 2017, pp. 13-14
Brigitte Giraud est écrivain, née en Algérie et vit à Lyon. Elle publié une dizaine de romans, récits, nouvelles dont « L'Amour est très surestimé » (Stock, prix Goncourt de la nouvelle 2007), « Une année étrangère » (Stock, prix Giono 2009), « Avoir un corps » (Stock 2013) et « Un loup pour l'homme » (Flammarion 2017), un roman autour de la guerre d'Algérie, en cours d'adaptation au cinéma. Ses livres sont traduits dans une quinzaine de langues.
Foto: © Lise Gaudaire

23. Januar 2019
Iris Wolf liest aus ihren Romanen
Moderation: Elisabeth Boner
rüffer & rub Sachbuchverlag, Alderstrasse 21, Seefeld
Iris Wolf, geboren 1977 in Hermannstadt/Siebenbürgen. Studium der Germanistik, Religionswissenschaft und Grafik und Malerei in Marburg an der Lahn. Langjährige Mitarbeiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach. 2013 Literaturstipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg, 2014 Ernst-Habermann-Preis, 2018 Literaturstipendium des Landes Baden-Württemberg. Mitglied im Internationalen PEN.
Im Otto Müller Verlag veröffentlicht:
«Halber Stein» (2012)
«Leuchtende Schatten» (2015)
«So tun, als ob es regnet» (2017)
14. November 2018
Ilma Rakusa und Michail Schischkin
Lesung und Gespräch
Moderation: Urs Heinz Aerni
rüffer & rub Sachbuchverlag, Alderstraße 21, Seefeld
Eine Begegnung mit zwei Menschen, die sprachlich mit der Welt auf Tuchfühlung gehen und sie hinterfragen.
lma Rakusa wurde am 2. Januar 1946 als Tochter eines Slowenen und einer Ungarin in Rimavská Sobota (Slowakei) geboren. Ihre frühe Kindheit verbrachte sie in Budapest, Ljubljana und Triest. 1951 übersiedelte sie mit den Eltern nach Zürich. Von 1965 bis 1971 studierte sie Slawistik und Romanistik in Zürich, Paris und St.Petersburg. Ihre Dissertation «Studien zum Motiv der Einsamkeit in der russischen Literatur» kam 1973 beim Peter Lang Verlag heraus. 1977 debütierte sie mit der Gedichtsammlung «Wie Winter». Seither sind zahlreiche Lyrik-, Erzähl- und Essaybände erschienen. Ilma Rakusa übersetzt aus dem Russischen, Serbokroatischen, Ungarischen und Französischen, als Publizistin («Neue Zürcher Zeitung», «Die Zeit») und als Lehrbeauftragte setzt sie sich für die Vermittlung osteuropäischer Literaturen ein. Ihre Arbeit wurde mit namhaften Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Sie ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, und lebt in Zürich.
Werke (Auswahl):
«Wie Winter». Gedichte, Edition Howeg, Zürich, 1977
«Die Insel». Erzählung, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1980
«Stepp». Erzählungen, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1990
«Langsamer! Gegen Atemlosigkeit»; Droschl, Graz, 2005
«Mehr Meer. Erinnerungspassagen», Droschl, Graz, 2009
«Alma und das Meer», SJW, Zürich, 2010
«Fremdvertrautes Gelände», Thelem, Dresden 2011
«Aufgerissene Blicke. Berlin Journal», Droschl, Graz, 2013
«Einsamkeit mit rollendem ‹r›. Erzählungen», Droschl, Graz, 2014
«Impressum: Langsames Licht». Gedichte, Droschl, Graz, 2018
Michail Schischkin gehört zu den wichtigen russischen Autoren der Gegenwart. Er wurde 1961 in Moskau geboren, studierte Linguistik und unterrichtete Deutsch. Seit 1995 lebt er in der Schweiz. Seine Romane »Venushaar« und »Briefsteller« wurden national und international ausgezeichnet, u.a. erhielt er als einziger alle drei wichtigen Literaturpreise Russlands. 2011 wurde ihm der Internationale Literaturpreis Haus der Kulturen der Welt in Berlin verliehen. Sein Roman «Die Eroberung von Ismail« wurde u.a. mit dem Booker-Prize für das beste russische Buch des Jahres (2000) ausgezeichnet. Der Übersetzer Andreas Tretner hat es ermöglicht, die vielen Anspielungen des Originals für deutschsprachige Leserinnen und Leser erfahrbar zu machen. Seine Bücher wurden in 27 Sprachen übersetzt. In Artikeln, Essays und in Sendungen wie Sternstunden von SRF beschäftigt er sich intensiv mit den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in Russland. Heute lebt Michail Schischkin als freischaffender Schriftsteller im Kanton Solothurn.
Werke (Auswahl)
«Montreux – Missolunghi – Astapowo. Auf den Spuren von Byron und Tolstoj», Limmat, Zürich, 2002
«Venushaart». Roman, DVA München, 2011
«Briefsteller». Roman, DVA München, 2012
«Auf den Spuren von Byron und Tolstoi. Eine literarische Wanderung von Montreu nach Meiringen», Rotpunkt, Zürich, 2012
«Die Eroberung von Ismael». Roman, DVA München, 2017
Foto von Ilma Rakusa: © Günther Rakusa; Porträt Michail Schischkin: © SRF

24. Oktober 2018
Sprache ist nicht gleich Sprache
Ulla Steffan und Marco Todisco im Gespräch
Eine Spurensuche mit Musik
Moderation: Urs Heinz Aerni
rüffer & rub Sachbuchverlag, Alderstraße 21, Seefeld
Sprache und Kultur sind untrennbar miteinander verbunden. Sprachen sind Werkzeuge des Ausdrucks, des Denkens und des Handelns, die wiederum unser Denken und Handeln beeinflussen. Über solche Zusammenhänge wird an diesem Abend ausgiebig parliert und musiziert. Unsere beiden Gäste bewegen sich in verschiedenen Sprachwelten und -kulturen.
Ulla Steffan stammt aus Deutschland, vermittelt als Verlagsmitarbeiterin internationale Geschichten im Unionsverlag und ist Kennerin sizilianischer Kultur und Lebensart.
Marco Todisco, Sohn italienischer Einwanderer, aufgewachsen in Graubünden, lebt als Musiker und Sportlehrer in Zürich. Er singt Geschichten sowohl auf Italienisch als auch in Mundart.
Unser Gastgeber und Vorstandsmitglied, Urs Heinz Aerni, stammt aus Solothurn, wäre eigentlich Zuger aber plaudert Aargauisch und pendelt zwischen Zürich und Graubünden.
Ulla Steffan, Buchhändlerin und Verlagsmitarbeiterin im Unionsverlag, ist nach mehreren längeren Aufenthalten in Sizilien Kennerin sizilianischer Kultur und Lebensart.
Marco Todisco, geboren 1972, Sohn italienischer Einwanderer, aufgewachsen in Graubünden, lebt als Musiker und Sportlehrer in Zürich. 2011 erschien im Zytglogge Verlag sein erstes Liedermacher-Album «Passatempo», 2015 sein zweites «Vivere accanto». Er ist zudem Moderator der italienischen Talk-Sendung «Caffè Todisco» bei Radio und TV Südostschweiz sowie Captain der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft der Schriftsteller.

19. September 2018
Gianna Olinda Cadonau
«Ultim’ura da la not – Letzte Stunde der Nacht»
Lesung in rätoromanischer/deutscher Sprache und Gespräch
Andri Steiner begleitet die Gedichte auf seiner Klarinette
Moderation: Flurina Peper
rüffer & rub Sachbuchverlag, Alderstrasse 21, Seefeld
Gianna Olinda Cadonau liest aus ihrem 2016 erschienen Gedichtband «Ultim’ura da la not – Letzte Stunde der Nacht». Es sind Gedichte aus dem Land zwischen Tag und Nacht, zwischen Gestern und Heute. Sie wird uns auch eine Kostprobe aus ihren unveröffentlichten Kurzgeschichten geben, wo wunderliche Tiere aus Träumen hervortreten und geheimnisvolle Türen uns in andere Dimensionen führen, Tschella vart - Da beschas magicas e portas clandestinas / Die andere Seite – Von magischen Tieren und geheimen Türen.
Begleitet wird Gianna Olinda Cadonau vom Saxophonisten/Klarinettisten Andri Steiner aus Lavin (GR). Seine Musik zeichnet Hügel, Abgründe, Wälder und Seen aus dem Land zwischen Tag und Nacht.
«Es sind Schnittstellen, welche die junge Dichterin faszinieren: der Schleier, der von der Nacht in den Tag führt; die Luft, welche Erde und Himmel trennt; die Länder des vertrauten und fremden Kontinents. Oder auch das Du, zwischen dem Ich und dem eigenen Ich. Fremdes und Verwandtes. Nähe und Ferne in sich selbst und um sich herum. In den Gedichten werden die Grenzen gesucht und ausgelotet, werden die Wurzeln ertastet, im Hoffen und Sehnen und auch im Schmerz.»
Aus: Nachwort von Mevina Puorger zum Gedichtband «Ultim’ura da la not – Letzte Stunde der Nacht»

9. Mai 2018
Thomas Hürlimann
Aufbruch und Heimkehr
Moderation: Ralph Müller
GZ Hottingen, Hottingersaal
Ein Gespräch mit dem Autor über Wendepunkte in seinem Leben und Schaffen, die Beschäftigung mit Gottfried Keller und die schwierige Arbeit an seinem Lebensroman, der im Herbst erscheinen wird
Im Sammelband «Der Sprung in den Papierkorb» beschreibt Thomas Hürlimann, wie er zum Autor wurde: Im ersten Text erfahren wir, wie der frühe Tod seines jüngeren Bruders ihn zum Dichter werden liess. Im letzten, wie ihn zur gleichen Zeit sein verehrter Berliner Philosophielehrer aus seiner Täuschungsblase befreite und ihm die Sicht auf das weite Land hinter dem eigenen Subjekt eröffnete. Auch die Hommage für den Doktor galt einem Toten, denn dieser war schon in den siebziger Jahren freiwillig aus dem Leben geschieden.
Thomas Hürlimann, 1950 in Zug geboren, war Stiftsschüler im Kloster Einsiedeln, studierte Philosophie in Zürich und Berlin, arbeitete als Regieassistent und Produktionsdramaturg am dortigen Schiller-Theater und hat seit 1981 eine beeindruckende Fülle von ganz eigenständigen Bühnen- und Prosawerken vorgelegt. Die ausgedehnten Lebensphasen in Berlin führten zu einem kritischen Blick auf die Geschichte unseres Landes, aber nie zur Verleugnung seiner Wurzeln in der katholischen Innerschweiz.
Mit dem Erzählungsband «Die Tessinerin» und dem Theaterstück «Grossvater und Halbbruder» stellte sich der Dreissigjährige 1981 gleich mit zwei Werken vor, die einen unverwechselbaren, neuen Klang in die deutschsprachige Literatur brachten und das gültige, tragfähige, Fundament eines Lebenswerks bildeten, das sich reichhaltig und vielfältig aus der Geschichte der eigenen Familie entwickelte.
Foto: © von Jannis Keil

11. April 2018
Sébastien Meier
« L’Ordre des choses »
Lesung und Gespräch
Modération: Martine Grosjean
in französischer Sprache
rüffer & rub Sachbuchverlag, Alderstraße 21, Seefeld
Le jeune auteur suisse romand vient nous parler du troisième roman de sa trilogie dans laquelle il tisse une intrigue haletante aussi bien parmi les milieux interlopes de clubs échangistes que dans les bureaux stériles de multinationales et de banques helvétiques peu scrupuleuses, entre les filets bien serrés du darkweb.
Sébastien Meier est né en 1988 en Suisse où il réside, du côté de Lausanne. Voyageur, danseur de flamenco, auteur de théâtre, membre du collectif AJAR (Vivre près des tilleuls, Flammarion, 2016), serveur, veilleur de nuit dans un foyer de l’Armée du Salut, fondateur de la maison d’édition Paulette, il est l’auteur, chez Zoé, d’une trilogie noire ayant pour cadre la Suisse, composée des « Ombres du métis » (2014), pour lequel il a reçu le Prix des lecteurs de la ville de Lausanne, du « Nom du père » (2016) et de «L’Ordre des choses » (2017).

7. März 2018
[Nach der kurzfristigen Absage des Autors aus Krankheitsgründen, las Sepp Estermann aus dem aktuellen Roman.]
Charles Lewinsky
Der Wille des Volkes
Moderation: Marise Lendorff - El Rafii
rüffer & rub Sachbuchverlag, Alderstrasse 21, Seefeld
Der pensionierte Journalist Kurt Weilemann erhält eine rätselhafte Botschaft von einem Kollegen, der kurz darauf stirbt. Weilemann will den Mord aufklären, bekommt es aber zuerst mit der Politik und dann bald mit der Angst zu tun, denn die Leute, die hier offensichtlich einen Mord durch einen weiteren vertuschen möchten, scheinen an entscheidenden Machtpositionen im neuen Staatsapparat zu sitzen. Mächtig genug, dass sie auch ihn verschwinden lassen könnten – und die Wahrheit gleich dazu.
«Er war in dem Alter, wo die Redaktionen nur noch anriefen, wenn wieder einer gestorben war, und sie einen Nachruf brauchten. ‹Sie haben ihn doch noch gekannt›, sagten die jungen Schnösel dann am Telefon und hatten so wenig Sprachgefühl, dass sie nicht merkten, wie verletzend dieses ‹noch› klang. ‹Die andern aus deiner Generation›, hiess das, ‹sind schon lang durch den Rost, nur dich hat man vergessen abzuholen.›» Aus: Der Wille des Volkes, Kriminalroman. Nagel & Kimche
Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor. Er schreibt Hörspiele, Romane und Theaterstücke und verfasste über 1000 TV-Shows und Drehbücher, etwa für den Film «Ein ganz gewöhnlicher Jude» (Hauptdarsteller Ben Becker, ARD 2005). Für den Roman «Johannistag» wurde er mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet. Sein Roman «Melnitz» wurde in zehn Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. in China als Bester deutscher Roman 2006, in Frankreich als Bester ausländischer Roman 2008. Lewinskys jüngsten Romane wurden für die bedeutendsten deutschsprachigen Buchpreise nominiert: «Gerron» für den Schweizer Buchpreis 2011, Kastelau für den Deutschen Buchpreis 2014 und Andersen für den Schweizer Buchpreis 2016.
Foto: © Claudia Gerrits
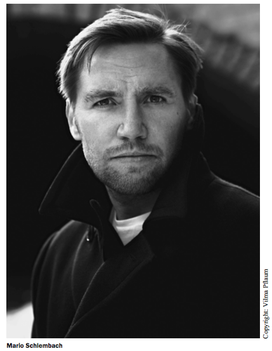
17. Januar 2018
Mario Schlembach
«Nebel»
Moderation : Elisabeth Boner
rüffer & rub Sachbuchverlag, Alderstrasse 21, Seefeld
«Typisch Österreich, Hubert! Nichts da, und selbst was da ist, wird verschandelt.» Mit diesem Paukenschlag beginnt das Lesevergnügen, beginnt das Lamento von Hedwig, die vieles ist, aber noch weit mehr hätte werden können, wenn ihr Mann jener Dichter geworden wäre, zu dem sie ihn machen wollte. Doch Hubert schreibt sein «Opus Magnum» nicht, verweigert sich.
Der erste Roman von Mario Schlembach ist nicht nur eine sprachgewaltige Satire mit viel Wortwitz, die keine Angst vor Klischees hat, sondern auch ein originelles Vademecum für all jene, die Österreich bereits kennen oder erst kennen lernen wollen.
«Hubert, du wärst ohne mich nichts gewesen. Erst ich habe deinem Hass, deiner Rohheit eine Bühne, ein Ventil gegeben. Ich habe dein Talent erkannt und probiert, dich in die Höhe zu treiben, dich anzustacheln, mit allem, was ich war und hatte. Ich versuchte dich zu reizen, bis du künstlerisch einfach explodieren musstest. Brachte Prozesse der Unterdrückung in Gang, um etwas Grossartiges aus dir herauszubekommen. Der glückliche Künstler schafft nichts. Leiden, Hubert, nur Leiden schafft etwas. Leid und Unterdrückung sind seit jeher der Nährboden der Literatur gewesen. Hubert, ich habe mit aller Entschlossenheit versucht, Hebamme deines Werkes zu sein. Ich habe dich gereizt, dich mit Fragen bombardiert und dich zu Antworten gezwungen (...) Bis heute hatte ich die Hoffnung, dass dich eine Idee trifft, Hubert, und jetzt hat dich der Schlag getroffen. Das wollte ich wirklich nicht.»
Mario Schlembach, geboren 1985, studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte bilden die Theorien der Autorschaft sowie Thomas Bernhard. Mario Schlembach arbeitete unter anderem als Bestattungshelfer, Buchhalter, Lokalreporter, Pöstler, Texter, Totengräber. Seit 2012 lebt er als freischaffender Künstler in Wien.
Werke:
Dichtersgattin, Otto Müller Verlag, Salzburg 2017
Nebel, Otto Müller Verlag, Salzburg März 2018


3. Dezember 2017
Pietro de Marchi
Lesung und Gespräch
in italienischer Sprache
Moderation : Barbara Wangler
rüffer & rub Sachbuchverlag, Alderstrasse 21, Seefeld
Pietro De Marchi wurde 1958 geboren und ist in Milano aufgewachsen. Seit 1984 lebt er in Zürich. Er unterrichtet italienische Literatur an den Universitäten Zürich, Neuchâtel und Bern. Pietro De Marchi schreibt Gedichte und Kurzprosa. Für seinen Gedichtband «Replica» erhielt er 2007 den Schillerpreis. Für seinen letzten Gedichband «La carta delle arance» wurde ihm 2016 der Gottfried Keller Preis verliehen.

6. September 2017
Kathy Zarnegin
«Chaya»
Moderation: Josef Estermann
rüffer & rub Sachbuchverlag, Alderstrasse 21, Seefeld
Teheran, 70er Jahre: Ein junges Mädchen beschließt, Schriftstellerin zu werden, und träumt von Europa. Kaum ist sie aus dem turbulenten Iran im Herzen Europas angekommen, verwandelt sich das neugierige Kind im Schnelldurchlauf in eine Frau, die plötzlich «vor dem Leben» steht: Wie rasch lerne ich die neue Sprache, wie komme ich an Geld, was mache ich mit meinen Träumen, wo finde ich den, mit dem es sich lieben lässt?
Chaya ist ein Paradiesvogel. Unangepasst, freiheitshungrig, eine Frau, die sich von nichts und niemandem schrecken lässt, ein Großstadtwesen und manchmal sogar ein quittengelber Kanarienvogel. Wie damals «Zazie in der Metro» streift Chaya abenteuerlustig durch eine Welt, die sich vor ihr in eine wundersame bunte Kugel verwandelt.
Kathy Zarnegin wurde in Teheran geboren und kam mit 15 Jahren in die Schweiz. Sie ist Lyrikerin, Essayistin, Übersetzerin aus dem Persischen, Philosophin und promovierte Literaturwissenschaftlerin. Sie ist Mitbegründerin des Lacan Seminar Zürich und Mitorganisatorin des Internationalen Lyrikfestivals Basel. «Chaya» ist ihr erster Roman.

17. Mai 2017
Elisabeth Wandeler-Deck
Burkhard Jahn
Gedichte lesen und hören, miteinander Sprechen und diskutieren
Moderation: Marise Lendorff-El Rafil
rüffer & rub Sachbuchverlag, Alderstrasse 21, Seefeld
falz
«falz um falz.
und. jetzt? naja. jetzt. jetzt im.
fall. im fall, jetzt, das rauschen des.
ich bist bin bin. im istfall. bin ja längst alt. ab da das frohe multi. ist bin. na ja knapp. knapp kirschen, beeren, käfer, etc. drum. um drum.»
Elisabeth Wandeler Deck
«Zum Lachen sind die Stunden, die einmal vor Hoffnung lachten,
ach, aller Stunden Ziel ist nur: uns nach dem Leben trachten.
O Zeit, o Lied vom Lebensglück, vom unfassbaren Stöhnen,
O Zeit, des Teufels Meisterstück, uns alle zu verhöhnen.
O Zeit, der Kosmos widerhallt
von Deinem ew’gen Dröhnen. Gleichwohl: o Tod, komm nicht so bald! Ich will doch hier auf Erden,
ich will doch tausend Jahre alt,
will tausend Jahr alt werden!»
Burkhard Jahn
Elisabeth Wander-Deck, 1939, studierte zunächst an der ETH Zürich Architektur und einige Jahre später an der Universität Soziologie und Klinische Psychologie. Seit 1975/76 widmet sie sich vermehrt ihrer schriftstellerischen Tätigkeit. Mit ihrem anarchischen Schreibansatz öffnet sie sich immer wieder ganz unterschiedliche the- matische Felder. Gekonnt gelingt ihr eine einzigartige Verknüpfung von Text um Musik - im Rhythmus der eigenen Texte ebenso wie bei Lesungen, wenn beispielweise Vorleserstimme und Musikinstrumente eine untrennbare Symbiose eingehen. Anerkennungspreis der Stadt Zürich 2012, Basler Lyrikpreis 2013.
Publikationen (Auswahl):
«Da liegt noch ihr Schal» (Prosa 2009); «ANFÄNGE ANFANGEN gefolgt von UND» (Lyrik 2012); «Beharrlicher Anfang – doch doch sie singt» (Hörstück 2012); «Ein Fonduekoch geworden sein» (Prosa 2013); «Das Heimweh der Meeresschildkröten – Heterotopien der Nacht» (Prosa 2015); «arioso – archive des zukommens» (Lyrik 2016)
Burkhard Jahn, 1948, studierte Germanistik, Publizistik und Kunstgeschichte. Nach dem Besuch der Schauspielschule in Hamburg widmete er sich ganz dem Theater. Burckhard Jahn stand unter ande- rem als Hamlet, Oedipus und Mechael Kohlhaas auf den grossen Bühnen Deutschlands (Staatstheater Saarbrücken, Theater der Stadt Bonn, Schaupielhaus Bochum, Hamburger Kammerspiele und viele mehr). Zudem schrieb er Libretti für Musikwerke und veröffentlichte Lyrik, Prosa Feuilleton-Beiträge.
Fachingen Kulturpreis 1987, 2. Preis im Ersten Berner Lyrik-Wettbewerb 1997.
Publikationen (Auswahl):
«Himmelblauer November» (Gedichte, 2016)
Im Frühjahr 2017 erscheint der Roman «Der Weg an der Sarca» im Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra und Wien

12. April 2017
Lionel Felchlin
Gertrud Leutenegger
Une soirée franco-allemande
Ein deutsch-französischer Abend
Traducteur rencontre / trifft Autorin
Moderation: Martine Grosjean
In französischer und deutscher Sprache
rüffer & rub Sachbuchverlag, Alderstrasse 21, Seefeld
Cette rencontre permettra aux lecteurs francophones et germanophones de prendre conscience des difficultés et des enjeux du processus de la traduction, d’en comprendre les subtilités, de s’immerger dans le monde du traducteur et de partager sa complicité avec l’écrivaine, qui de son côté participe à la transposition de son propre texte dans une autre langue.
Les lectures d’extraits de son œuvre par Gertrud Leutenegger en allemand suivies de leur traduction par Lionel Felchlin, illustreront le propos en dévoilant la complexité et la beauté du travail sur les langues, ainsi que celles de la littérature.
Lionel Felchlin, né à Berne en 1980, concilie traduction et vie d’orchestre après des études de lettres, de traduction littéraire et de musique en Suisse romande. Il a participé au programme franco-allemand Georges-Arthur Goldschmidt pour jeunes traducteurs littéraires en 2013 et à la promotion 2015-2016 de l’École de traduction littéraire du CNL à Paris.
Dernières traductions :
Peter von Matt: « La Poste du Gothard ou les états d’âme d’une nation » (2015), « Don Quichotte chevauche par-delà les frontières. L’Europe comme espace d’inspiration » (2017)
Lukas Bärfuss: « Koala » (2017)
En préparation: Gertrud Leutenegger: «Panischer Frühling» (« à paraître en août »)
Gertrud Leutenegger, geboren 1948 in Schwyz, veröffentlicht seit 1975 zahlreiche Romane, Erzählungen, Gedichte und Theaterstücke; ein Werk, für das sie vielfach ausgezeichnet wurde. Sie lebte viele Jahre in der italienischen Schweiz, heute wohnt sie in Zürich.
Zuletzt erschienen:
«Pomona» (2004)
«Matutin» (2008)
«Panischer Frühling» (2014)
Weitere Gäste beim Literarischen Club Zürich waren u.a.:
BaldWiena FolksWaisen
Anne Rüffer
Max Lobe
Leta Semadeni
Christian Haller
Elias Schneitter
Roman Graf
Amina Abdulkadir und Edmauro de Oliveira
Silvia Blatter
Erika Burkart
Magdalena Vogel
Manfred Züfle
Franz Hohler
Hanna Johansen
Hugo Loetscher
Otto F. Walter
Heinz D. Heisl
Frederike Krezen
Mitra Devi
Jürgen Kehrer
Elias Schneitter
Hanspeter Müller-Drossaart
Graziella Rossi und Helmut Vogel
Sandra Lüpkes
Irene Prugger
Alex Capus
Daniel de Roulet
Jürg Beeler
Beat Brechbühl
Catalin Dorian Florescu
Urs Mannhart
Unsere Unterstützer
Wir danken ganz herzlich der Stadt Zürich und der Stiftung Felsengrund für ihre grosszügige Unterstützung!
Alle Veranstaltungen sind öffentlich und werden durch Mitgliederbeiträge, Eintritte und Spenden ermöglicht.
Spenden werden schriftlich bestätigt.
Sie wollen den Literarischen Club Zürich unterstützen und dafür sorgen, dass unser traditionsreicher Club langfristig bestehen kann? Wir freuen uns über Ihre Spende und/oder Ihre Kontaktaufnahme.
CH 11 0025 1251 9012 0401 D; UBS Literarischer Club Zürich
c/o Urs Heinz Aerni, Schützenrain 5, 8047 Zürich
Der Literarische Club im Internet: www.literarischerclubzuerich.com, auf Facebook und Instagram (@literarischerclubzurich).